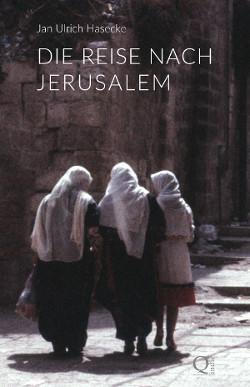Im Übergangszustand Ostdeutschlands
Große rote Lettern stechen aus der Warntafel hervor: “Objektbezogene Alarmierung bei Bränden und Havarien”. Dieses Plakat im Treppenhaus des Chemielaborgebäudes in der August-Bebel-Straße war einer meiner ersten prägenden Eindrücke in Jena. Und auch während des gesamten Semesters, in dem ich hier Chemie studierte, zeigte es mir immer an, daß ich hier noch nicht ganz zu Hause war.
In Jena sprach man von “Zielstellung” statt “Zielsetzung”, Kunststoffe ware hier “Plaste und Elaste”. Der Titel gehörte zur Anrede, und auch das “Fräulein” galt als Norm. Ich hörte manchmal Redewendungen wie “Er ist orientiert worden auf 16 Uhr” oder das in westdeutschen Ohren so fatalistisch klingende Versprechen “Das geht seinen Gang”. Schon ausgestorben waren der “Broiler”, ein gegrilltes Hähnchen, und auch kein Restaurant hätte mehr Kartoffeln als “Sättigungsbeilagen” offeriert. Sehr bald, gleich im September 1990, lernte ich auch, daß Thüringisch nicht Sächsisch ist und auch nie so bezeichnet werden darf.
Nach einer kurzen beiderseitigen Unsicherheitsphase bin ich in der Sektion Chemie an der Jenaer Friedrich-Schiller-Universität ausgesprochen freundlich, beinahe herzlich, und übrigens auch erstaunlich unbürokratisch aufgenommen worden. Auf dem Siegel meines Studentenausweises waren bereits Hammer und Zirkel aus dem Ährenkranz entfernt.
Im Praktikum gab man sich mit mir große Mühe und erstellte ein Programm, mit dem ich mich an meiner West-Uni sehen lassen konnte. Angenehm war, daß mancher Versuchsbetreuer meinte, er habe für meine guten Leistungen Sorge zu tragen, schließlich hatten ja die Ausbilder ihr Plansoll zu erfüllen. Man schilderte mir bald die Mängel in der Ausstattung, als ob ich als Richter gekommen wäre, an dessen Seite man lieber als Mitankläger stünde.
In der Stadt überwog noch der Optimismus, der Glanz des Westens war noch nicht ermattet: Die neuen großen schnellen Autos mit den klingenden Namen, die schreienden Händler auf dem Platz der Konsumenten, der eigentlich noch “Platz der Kosmonauten” hieß. Die großen gestreiften Kaufhauszelte, die endlich verfügbaren Bücher, farbenfrohe modische Kleidung. In der Mensa wurde das Aluminium-Besteck gegen eisernes ausgetauscht. Dann überklebte die Volkspolizei ihre erste Silbe, und es kamen die neuen Nummernschilder mit dem “J”. Die russischen Soldaten wurden immer schüchterner, ein kesser blütenweißer Edeka-Laster stahl den Konvois schwerfälliger, dunkler, russischer Militärfahrzeuge stets die Schau.
** *
Das Auseinanderhalten von Bekanntem und Fremdem war mir, vor allem bei meinen beschränkten Möglichkeiten zu einer wissenschaftlich-anthropologischen Feldforschung, ein kaum lösbares Problem. Wieviel an der Karikatur des Ossis dran ist, wollte ich wissen. Ist er träge? Wartet er auf Weisungen? In erster Näherung ist dieses Klischee wohl genauso falsch, wie das Gegenstück des arroganten, bevormundenden und zur Freundschaft unfähigen Wessis, der in gestylter Kälte seine wohlhabende Einsamkeit fristet. Wie sehr entwickelten sich die Menschen auseinander, die vierzig Jahre getrennt und verschiedenen Einflüssen ausgesetzt waren? Was bewirkte die permanente Bevormundung durch den Staat? Mit der Zeit lernte ich die Vorgeschichte mancher Menschen kennen. Oft konnte ich mich in den Zielen und Ängsten, in den Schilderungen vom Mut und vom Ducken wiederfinden.
Unterschiede bemerkte ich natürlich auch: im Osten wurde nach der Beschaffbarkeit, nicht nach dem Preis bewertet. Die Qualität der Nahrung wurde durch die Fleischmenge bestimmt, und kaum jemand hätte mit Ballaststoff- oder Cholesterin-Mengen jongliert.
Sicherlich haben es bunte Vögel in einer Gesellschaft schwerer, die auf ein Mittelmaß gehalten wird, das der Kleinbürger prägt. Das Leben der Ostdeutschen fand in privaten Nischen statt, die der Staat immer vergeblich sich anzueignen versuchte. In Familien und Freundeskreisen wurde anders gesprochen, ferngesehen und gewitzelt. Genüßlich wurde hier die offizielle Sprache nachgeäfft, Wohnsilos nannte man “Arbeiterschließfach”, Nichtstun hieß, “den Plan vorfristig übererfüllt zu haben”. Diese “andere DDR” war der privilegierten Hauptstadt fern. Die Flucht ins Private ist vielleicht ein Beispiel für jene auf Selbstbewahrung gerichtete “Resistenz”, von der Martin Broszat einmal meinte, sie sei die einem autoritären Staat “gemäßere” Form der Opposition als der aktive Widerstand.
** *
Das Chemie-Studium war bisher über fünf Studienjahre auffallend schulmäßig organisiert. Jeden Herbst begannen nicht mehr als etwa 50 Studenten - davon die Hälfte weiblich -, die auf vier Seminargruppen verteilt gemeinsam durchs Studium gingen. Vielleicht 35 erlangten ihr Diplom und bekamen dann vom »Sekretariat für Erziehung (!) und Ausbildung« für die nächsten drei Jahre einen Arbeitsplatz zugewiesen. Die Promotion war nur wenigen vorbehalten, die, wenn sie über die Doktorarbeit hinaus an der Universität blieben, die Forschung trugen. Studenten kamen bereits früh in Kontakt zu Wissenschaftlern und konnten dabei individuell gefördert werden.
Im Laufe der Zeit erfuhr ich, wie früher die paramilitärischen Übungen aussahen: Frauen und Verweigerer mußten in der Nähe von Leipzig einen vierwöchigen “Zivilschutz-Kurs” absolvieren, während die Männer, denen man schon vor dem Studium drei Jahre Wehrdienst “nahegelegt” hatte, nun eine Offiziersschulung belegten. Im normalen Lehrplan waren Wehrsport und das Diplomfach Marxismus-Leninismus enthalten. Während des “Studentensommers”, einige Wochen in den Sommerferien, erwartete man eine Teilnahme an Fabrik- oder Feldarbeit. Unangepaßte Studenten wurden zur “Aussprache” geladen und saßen dort drei Professoren und dem FDJ-Sekretär gegenüber. Wer nicht, was schnell bekannt wurde, an den Wahlen teilnahm, mußte mit dem Verlust der Stipendienzulagen rechnen. “Störer” verdarben schließlich das Wahlbeteiligungs-Planziel, was den Verantwortlichen einen Rüffel einbrachte. Über die Stasi gab es natürlich nur Gerüchte: ein Spitzel soll, so sagte man, in jedem Studienjahr gewesen sein. Wer bei einem bestimmten Stasi-nahen Wachbataillion in Berlin gedient habe, sei verdächtig. Andere gaben zu bedenken, daß die Unverdächtigen verdächtiger sein könnten.
** *
Bei der Umgestaltung der Universität gesteht der Einigungsvertrag den Rechtsnachfolgern der DDR in bestimmten Fristen das Recht auf begründungslose Schließung von Instituten (mittels “Abwicklung”) und Nichtübernahme der Mitarbeiter (über die “Warteschleife”) zu. Ein weiteres Element der Umgestaltung ist die “Evaluierung”, die Prüfung der Hochschullehrer auf ihre fachliche und menschliche Eignung. Niemand bezweifelt, “daß in der Vergangenheit personelle Fehlentscheidungen getroffen wurden”, wie es auf einem Uni-Aushang heißt: gute Dozenten ohne Parteibuch bekamen vom Ministerium keine Professur. Andere, die sie nur aufgrund ihres Parteiabzeichens, dem “roten Bonbon am Kragen”, erhielten, hatten dann aber vielleicht die besten Doktoranden zugeteilt bekommen, so daß man sie an ihren Veröffentlichungen kaum erkennen kann. Und was die menschliche Seite betrifft: Einem als tyrannisch bekannten Professor haben die Mitarbeiter eine Ehrenerklärung ausgestellt. Sie fürchteten, gleich nach ihm auf der Straße zu stehen. Ihre Sorge ist nicht grundlos, da auf nur sechstausend Studenten fast zehntausend Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Angestellte kommen, weit mehr als es im Westen üblich ist. Zudem werden in der Chemie künftig Forschungsmittel an Promotionen gebunden sein, so daß hier ältere Chemiker leer ausgehen könnten. Die geplante deutliche Erhöhung der Studentenzahl soll die Proportion von zu wenigen Studierenden und zu vielen Wissenschaftlern verbessern.
Für weitere Zermürbung sorgten die regelmäßigen Wechselbäder aus der heftig brodelnden Gerüchteküche: Einmal hieß es, in Bonn meinte man, es sei einfacher, in der Landeshauptstadt Erfurt eine neue Uni zu errichten, als die in Jena zu erneuern. Für viele der neuen Bundesbürger war es eine verwirrende Überraschung gewesen, daß nun staatliche Stellen unterschiedliche politische Ziele vertreten und daß Gerichte Entscheidungen anderer Institutionen aufheben können. Es verwundert nicht, daß ich in dieser Situation, als wäre ich Rechtsanwalt, immer wieder Auskunft, etwa zum Arbeits-, Miet- oder Versicherungsrecht, geben mußte. Die Anschaffung eines Rechtswörterbuchs rentierte sich bald.
Man hofft, daß sich mit den steigenden Mieten auch für die Studenten die Wohnsituation entschärft, denn für Privatvermieter kann die Untermiete nun entweder zur lukrativen oder zur notwendigen Nebeneinnahme werden. Bislang wohnt die Mehrheit der Studenten in Wohnheimen. Das Studentenwohnheim “Anna Seghers”, in dem ich zusammen mit einem Erfurter Chemie-Studenten auf 12m² für 10 DM im Monat unterkam, zählt zu den besseren. Duschen im Keller und Waschräume werden, gar nicht so kleinbürgerlich, von Frauen und Männern gemeinsam benutzt. Dem Elan der Hausleiterin ist es zu verdanken, daß in diesem Sommer die Kakerlaken verschwinden sollen und die Heizung, deren tiefschwarze Rauchfahne gegen die eigenen Fenster steht, ausgetauscht wird. Im Studentenklub, der Kneipe, Tanz-, Diskussions- und Vortragsraum zugleich ist, kann man seine Mitbewohner schnell kennenlernen. Hier pulsiert ein Teil des studentischen Lebens, und zugleich ist hier auch ein Refugium einer typischen DDR-Gemütlichkeit, in der, wenn jemand seine Klampfe hervorholt, Jugend- und Studentenlieder gesungen werden. Leider wollen einige im Thüringer Studentenwerk dem Klub das Wasser abdrehen, schließlich gibt es in Thüringens Musterland Hessen nichts Vergleichbares.
** *
Jena, die Einhunderttausend-Einwohner-Stadt, liegt im romantischen Saaletal und nahe dem Thüringer Wald. Ein paar Bergrücken ließ Goethe abholzen, damit ihn die weißen Muschelkalkfelsen an Italien erinnerten. Jena könnte ein thüringisches Heidelberg sein, stünden die alten Häuser in frischerer Farbe. Am Markt sind zwar die Fachwerk-Fassaden herausgeputzt, aber eben vor allem die Fassaden. Vierzigtausend Einwohner leben in Hochhausvororten wie der “sozialistischen Wohnstadt” Neu-Lobeda, die den Vorurteilen der arrogantesten Westdeutschen standhält. Unübersehbar die Stadt beherrschend steht der Uni-Turm, ein riesiger Zylinder aus Fenstern, der sich als Phallussymbol aufdrängte, könnte man nicht erfahren, daß er nur die erste Baustufe eines einstmals geplanten überdimensionalen Fernglases darstellt, in das die Carl-Zeiss-Forschung hineinziehen sollte. Wegen statischer Probleme zogen dann aber die leichteren Geisteswissenschaften der Uni in das, wie sich nun herausstellt, asbesthaltige Bauwerk ein.
Bald nach den Dezember-Wahlen, etwa seit Mitte Januar, als das Ausmaß der Misere deutlich wurde, änderte sich die Stimmung. Die optimistischen Handwerker wurden stiller. Auch wenn die Regierung an den hohen Erwartungen scheitern mußte, hätte sie wahrhaftiger sein sollen. Bei den Intellektuellen schlug das emanzipatorische Pendel zurück: sie wollten nicht mehr einfach den Wessis gleich werden, sondern betonten nun ihre Eigenheiten. Oft hörte man ein bitteres, manchmal anklagendes “Hier war auch nicht alles schlecht”. Die Wessis stülpen ja auch tatsächlich ihre Normen auf, ohne das Alte zu prüfen. Wenn es gut war, war es eben meist zu teuer.
Man wird wohl lernen müssen, daß die in vierzig Jahren entstandenen Mechanismen, Institutionen und Gesetze der Bundesrepublik, auf andere Gesellschaften angewandt, zwar einerseits störend wirken können, daß sie aber andererseits deshalb nicht selbst schlecht sein müssen. Man kann eine nach jahrzehntelanger Entwicklung gewachsene Situation nicht mit den Modellen und Ideen des Runden Tischs messen, da diese sich nie in der Praxis bewähren konnten. Oft höre ich die Sorge um Kindergartenplätze. Frauen mit guter Ausbildung fürchten, aus der Arbeitswelt verdrängt zu werden. Außerdem wurden häufig bestimmte Straßenverkehrsbestimmungen (“grüner Pfeil”, Tempolimit, Alkoholverbot) und das Müllverwertungssystem genannt, das in krassem Gegensatz zur entstandenen Müllflut empfunden wurde. Alle diese Anliegen ließen sich innerhalb der bundesdeutschen Gesellschaft berücksichtigen. Das West-System hat also - aus physikalisch-chemischer Sicht betrachtet - im Evolutionsprozeß den Vorteil, sich anpassen zu können, ohne die Systemfrage stellen zu müssen. Es ist nicht auf eine kleine ökologische Nische in der Geschichte angewiesen. In unser nun gemeinsames gesamtdeutsches Laboratorium sollten die Ostdeutschen unverdrossen ihre Kenntnisse von Osteuropa, ihre Fähigkeit, über sich lachen zu können und die vielen Erfahrungen der vierzig Jahre DDR einbringen. Selbst wenn es keine mutige Selbstbefreiung gegeben hätte und wenn bei ihnen nur Scheitern zu finden gewesen wäre, sie könnten um diese Erfahrung reicher sein.
Essen, im März 1991.