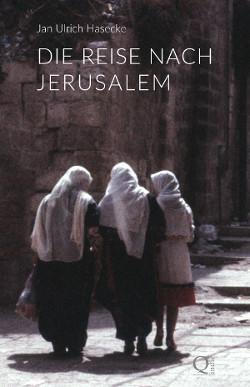Ich wurde 1966 geboren, also im letzten Jahr der Regierung Ludwig Erhards, mit dessen Namen man unwillkürlich selbst heute noch die Ära des so genannten Wirtschaftswunders verbindet. Wenig später sollten mit der Studentenrevolte ganz andere, für viele weniger beschauliche Jahre, in denen Pessimisten zeitweilig die Auflösung des Staates befürchteten, eingeleitet werden. Natürlich ging die zweite Hälfte der Sechziger für mich als Kleinkind recht ereignislos vorüber. Aus jener Zeit habe ich lediglich aus meiner eigenen kleinen Welt einen Krankenhausaufenthalt in deutlicher Erinnerung, bei dem mich Nonnenschwestern gegen meinen erklärten Willen mit Spinat zwangsfütterten, sowie einen Überfall mehrerer Kinder, die mir auf offener Straße ein trockenes Brötchen raubten, an dem ich friedlich gekaut hatte.
Die Nachwirkungen der Ereignisse der großen Welt sollten sich in der Stadt Wesel am Niederrhein, wo meine Eltern Ende der Sechziger begannen, ein Reihenhaus zu bauen, erst langsam in den siebziger Jahren zeigen, um dann umso bewusster von mir als Jugendliche zur Kenntnis genommen zu werden.
Ich wurde 1972 in Wesel eingeschult, in Wesel-Flüren, um es genau zu sagen, denn Flüren war der Stadt Wesel erst 1969 im Rahmen einer kommunalen Neugliederung eingemeindet worden. Ursprünglich war Flüren bis in die sechziger Jahre hauptsächlich Bauernland gewesen, auf welchem Anfang der Siebziger sehr schnell Bungalows und Einfamilienhäuser errichtet wurden, welche sich junge Familien kauften. So wie meine Eltern, die ihr Haus 1970 mit mir und meinem um ein Jahr jüngeren Bruder bezogen hatten. Wesel-Flüren war ein junger, rasant wachsender Ortsteil. In meiner Grundschulklasse gab es nicht viele Kinder, die in einem Mietshaus wohnen mussten. Die wenigen, auf die das zutraf, waren meinem Verständnis nach die, die man meinte, wenn man bei uns in Wesel-Flüren von armen Kindern sprach und nicht gerade von den Entwicklungsländern die Rede war. Meine über lange Dauer beste Freundin in der Grundschule musste nicht nur in einem Mietshaus wohnen, sondern war dazu noch eines jener Kinder, für die in der Jugend meiner eigenen Eltern das Wort »Schlüsselkind« erfunden worden war.
Zur Nachkriegszeit hatte man vermutlich die Notwendigkeit, dass Kinder, wenn sie vom Schulunterricht heimkamen, auf sich selbst gestellt waren, als unvermeidlich angesehen; nicht so in den siebziger Jahren bei uns in Wesel-Flüren. Weil beide Eltern arbeiten gingen und die Mutter nicht wie fast alle anderen Mütter zu Hause war, wenn ihr Kind aus der Schule kam, trug meine Freundin den Haustürschlüssel an einer Schnur um den Hals - eben um ihn nicht zu verlieren. Ein Schlüsselkind zu sein wurde von den Erwachsenen in meiner unmittelbaren Umgebung als etwas Schlimmes wahrgenommen. Zum einen war es Besorgnis erregend genug, wenn die Mutter es offensichtlich nötig hatte, überhaupt arbeiten zu gehen, denn dass die Mutter eines schulpflichtigen Kindes eine bezahlte Tätigkeit ausübte, weil sie es möglicherweise ohne zwingenden Grund wollte, schien damals ohnehin ausgeschlossen. Es musste sich also so verhalten, dass der Lohn des Vaters für die dreiköpfige Familie nicht ausreichte und diese deshalb auf das Dazuverdienen der Mutter angewiesen war. Die Vorstellung war traurig genug und den Erwachsenen durch das Wohnen im Mietshaus zusätzlich bestätigt. Statt eines von ihrer Mutter geschmierten Pausenbrotes hatte meine Freundin oft eine Mark in der Tasche, wofür sie von den Mitschülern natürlich beneidet wurde. Während die Tatsache, dass meine Freundin sich beim Bäcker selbst aussuchen konnte, was ihr schmeckte, wir anderen jedoch unser von zu Hause mitgebrachtes Pausenbrot aßen, unseren Neid gründlich erregte, wurde dies von den Erwachsenen als Anzeichen grober Vernachlässigung registriert und sehr emotional diskutiert. Verständlicherweise hätte sich manches von uns Kindern gewünscht, ebenfalls ein Schlüsselkind zu sein und statt des Pausenbrotes selbst ausgewählten Kuchen zu essen. Manche warfen ihr Pausenbrot direkt in den Mülleimer und wurden, wenn Lehrer sie dabei beobachteten oder Mitschüler sie verpetzten, immer wieder darauf hingewiesen, wie dankbar viele arme hungernde Kinder in der Dritten Welt für dieses Pausenbrot wären. Außerdem stellten wir uns vor, dass, wenn die Mutter nicht zu Hause wäre, auch nicht regelmäßig kontrolliert würde, ob man seine Schulaufgaben gründlich erledigte. Ich vermutete, dass ein Leben als Schlüsselkind unvorstellbare Freiheiten versprach.
Allerdings kündigten nicht nur Frauen, die es nötig hatten arbeiten zu gehen und Schlüsselkinder produzierten, den nahenden Untergang des Abendlandes an. Auch über antiautoritäre Erziehung wurde oft in meinem Beisein geschimpft. So weit ich dem folgen konnte, riskierten Eltern, die ihre Kinder nicht schlugen, nicht nur deren zweifellose Verwahrlosung, sondern erzeugten unausweichlich eine insgesamt steigende Jugendkriminalität und zahlreiche weitere unvorstellbare Übel, wodurch letztendlich die gesamte Kultur zu verrohen drohte. Ich persönlich wusste von keinem Kind, das von seinen Eltern nicht zur Sühne für seine Vergehen geschlagen wurde. Das galt als völlig alltäglich und üblich, und als mir - aber das war schon später im Gymnasium - eine Mitschülerin erzählte, sie sei noch nie von ihren Eltern geschlagen worden, mochte ich das nicht glauben. Selbstverständlich war ich gleichfalls der erlernten Ansicht, dass die antiautoritär erzogenen Kinder ganz besonders frech waren, wenngleich mir selbst keines bekannt war. Echte Strafe musste schon sein! Das sah ich ebenso.
Es war kaum ein Kind in meiner Schulklasse, das nicht wenigstens ein Geschwister hatte.
Im ersten Schuljahr gab es ein einziges Mädchen, das nicht am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht teilnahm, was wir alle nicht ganz verstanden, und was wir schließlich vergaßen, weil das Mädchen mit seinen Eltern ein halbes Jahr später aus Wesel-Flüren fortzog.
Es muss sogar ein Mädchen in meiner Klasse gegeben haben, dessen Eltern geschieden waren. Es galt als ein großer Makel, geschieden zu sein. Im Scheidungsrecht galt noch das Schuldprinzip, und wer schuldlos geschieden war, legte bei Bekanntschaftsgesuchen und ähnlichen Bemühungen Wert darauf, das zu erwähnen.
Ich erinnere mich sehr gut daran, dass einmal der von dem Mädchen in meiner Klasse als Vater bezeichnete Mann vom Lehrer mit einem anderen Nachnamen angesprochen wurde als dem, den das Mädchen trug. Dass Eltern andere Nachnamen als ihre Kinder haben könnten, war - erst recht aus kindlicher Sicht - zu der Zeit schwer vorstellbar. Den Hintergrund des Mädchens begriffen wir nie wirklich. Ich erfuhr nur durch das Belauschen eines Erwachsenengesprächs, dass die Eltern vermutlich geschieden seien und die Mutter des Mädchens mit dem Mann, der in der Schule vorgesprochen hatte, offenbar in wilder Ehe zusammenlebte. Das hörte sich sehr schlimm an und überstieg mein Vorstellungsvermögen. Ich wollte es lieber nicht genau wissen.
Während ich die Grundschule besuchte, hatte ich zu keinem Kind, dessen Eltern geschieden waren, Kontakt. Ich kann mich ebenso wenig bewusst daran erinnern, außer dem genannten Mädchen ein Kind gekannt zu haben, dessen leibliche Eltern nicht zusammenlebten. Die Welt in Wesel-Flüren schien - im Großen und Ganzen und an der Oberfläche jedenfalls - in Ordnung zu sein.
In der Grundschule standen wir auf, wenn unser Klassenlehrer den Raum betrat, und erwiderten seinen Gruß im Chor mit einem Guten Morgen! Es gab gelegentlich rüpelhafte oder nachlässige Schüler, die zögerlich oder gar nicht aufstanden. Diese wurden vom Lehrer zur Ordnung gerufen und zu «««< HEAD größerer Disziplin ermahnt. Der Lehrer wollte nicht schikanös auftreten. Er brachte sogar manchmal seine Gitarre mit und sang englische Shantys für uns, was immer große Begeisterung hervorrief. Er erklärte sein Verlangen danach, dass wir zum Grüßen aufstünden, damit, dass er schließlich auch vor der Klasse stehe, während er grüße. Dem war nichts entgegenzusetzen. Fortan standen wieder alle gleichzeitig zum Grüßen auf, wenn der Lehrer das Klassenzimmer betrat. Bis die Ersten
gröautoren: Jan Ulrich Haseckeßerer Disziplin ermahnt. Der Lehrer wollte nicht schikanös auftreten. Er brachte sogar manchmal seine Gitarre mit und sang englische Shantys für uns, was immer große Begeisterung hervorrief. Er erklärte sein Verlangen danach, dass wir zum Grüautoren: Jan Ulrich Haseckeßen aufstünden, damit, dass er schließlich auch vor der Klasse stehe, während er grüautoren: Jan Ulrich Haseckeße. Dem war nichts entgegenzusetzen. Fortan standen wieder alle gleichzeitig zum Grüautoren: Jan Ulrich Haseckeßen auf, wenn der Lehrer das Klassenzimmer betrat. Bis die Ersten
bootstrap von neuem nachlässig wurden.
Es gab noch so genannte Kopfnoten für Führung, Beteiligung am Unterricht und häuslichen Fleiß, die von Schülern wie Eltern ernst genommen wurden.
Mit einem Lehrbuch, das sich »Meine liebe Fibel« nannte, brachte man uns in der ersten Klasse das Lesen bei. Die liebe Fibel präsentierte uns eine heile Welt.
Das Fach Heimatkunde, in dem man ab der dritten Klasse hätte unterwiesen werden sollen, war durch Sachkunde ersetzt worden. In dem vorgedruckten Zeugnisheft stand immer noch Heimatkunde, so dass der Lehrer das Wort Heimat zwei Grundschuljahre lang durchstreichen und durch die Silbe Sach- ersetzen musste.
Mein Religionslehrer, der zugleich der katholische Pfarrer war, den jeder kannte, weil die beiden Kirchen in Wesel-Flüren mit Messdienern, Erwachsenen- und Kinderchor, Pfadfinderschaft und Frauengemeinschaft im gesellschaftlichen Leben keine unerhebliche Rolle spielten, erzählte gelegentlich vom Krieg, an welchem er selbst als Soldat teilgenommen hatte. In seiner Kirche nahmen mein Bruder und ich die Sakramente der Kommunion und der Firmung entgegen. Viele Gemeindemitglieder in Wesel-Flüren gingen jeden Sonntag zum Gottesdienst.
Die Grundschule war koedukativ. Ein Klassenfoto aus dem Jahr 1972 zeigt siebzehn Jungen und siebzehn Mädchen. Ich erinnere mich, dass sich einige der Jungen vorn in der ersten Reihe auf den Boden setzen mussten, damit alle vierunddreißig Kinder aufs Bild passten. Von einem Mädchen hätte man das nicht verlangt, denn zum einen hätte es sich dabei ja schmutzig machen können, und Anfang der siebziger Jahre galt es als «««< HEAD verhältnismäßig wichtig, dass Mädchen sich weder schmutzig machten noch
verhältnismäautoren: Jan Ulrich Haseckeßig wichtig, dass Mädchen sich weder schmutzig machten noch
bootstrap schmutzige Worte benutzten. Zum anderen hätten sich die Mädchen in ihren kurzen Polyesterkleidchen kaum würdig auf den Boden setzen können. So würdig, dass man die Unterhose nicht gesehen hätte, jedenfalls nicht. Es war Sommer, und im Sommer trugen wir Mädchen früher kurze Polyesterkleidchen; dass ein Mädchen eine kurze Hose trug, war eine Ausnahme, und dass ein Kleidchen Anfang der Siebziger nicht aus Polyester war, ebenfalls. Ich selbst trage auf dem Foto ein rotes Polyesterkleid, auf dem aus dekorativem Stoff ein Apfel aufgenäht ist.
Meine Großmutter hatte mir dieses Kleid geschenkt. Sie arbeitete zu der Zeit hinter der Fleischtheke im Kaufhof in Oberhausen und erhielt wie das übrige Personal Prozente auf ihre Einkäufe, und die Geschenke der Oma waren immer sehr geschätzt, kamen sie doch exotischerweise aus der großen Stadt. In Wesel-Flüren, bei uns im Dorf, kaufte meine Mutter oft auf dem Markt Kleidung für meinen Bruder und mich.
Wenngleich mir das kurze Kleid mit dem aufgenähten Apfel gefiel, denke ich insgesamt eher ungern an die kurzen Röckchen zurück und ganz besonders ungern an das dümmliche Spiel, präziser gesagt: die dümmliche Provokation, die sich »Deckel hoch, der Kaffee kocht« nannte. Das Spiel bestand darin, dass ein Junge an einem Mädchen vorbeilief, diesem den kurzen Polyesterrock hochhob und den unglaublich geistlosen Spruch ausrief: »Deckel hoch, der Kaffee kocht.« Nun war man in der ersten oder zweiten Klasse, und der Begriff sexuelle Belästigung war wahrscheinlich kaum einem Erwachsenen bekannt, vermutlich war er nicht einmal erfunden. Ich erinnere mich, dass »Deckel hoch, der Kaffee kocht« mit allen Mädchen gespielt wurde, nur daran, dass das eins der Mädchen lustig fand, kann ich mich nicht erinnern. Es hat sich aber niemand nachhaltig und öffentlich darüber beklagt. Es war auch nicht so, dass - konsequenterweise - nun im Sommer kein Mädchen mehr im kurzen Röckchen zur Schule gekommen wäre oder Eltern sich in der Schule beschwert hätten. Ich glaube nicht einmal, dass das zu Hause erzählt wurde; ich selbst habe meinen Eltern mit Sicherheit nicht davon berichtet. Man hätte wahrscheinlich sowieso nur darüber gelacht. So war das eben.
Es wurde viel mit zweierlei Maß gemessen. So zum Beispiel schlugen Mädchen einander nicht, und ein Junge durfte ein Mädchen erst recht nicht schlagen. Mädchen zankten sich höchstens, und zwar auf weibische Art, sie kratzten und bissen einander. So hörte man. Ich selbst habe mich allerdings nie mit einem anderen Mädchen gekratzt oder gebissen. Tatsächlich ist es mir aus meiner gesamten Grundschulzeit nicht gegenwärtig, je zwei sich physisch zankende Mädchen gesehen zu haben. Jungen hingegen kloppten sich. Gelegentlich gab es in der großen Pause eine Klopperei zwischen zwei Jungen. Ich weiß genau, dass es wirklich immer nur zwischen zweien war, denn ich habe noch heute den kindlichen Ehrenkodex »zwei auf einen ist feige« im Ohr. Um die sich kloppenden Jungen bildete sich jeweils im Nu eine Traube von Zuschauern, bis ein Lehrer eingriff und die Kämpfenden auseinander brachte.
In der Grundschule gab es die Strafe, an die Wand gestellt zu werden. Für ein Vergehen die gesamte große Pause, und je nach Schwere des Vergehens möglicherweise sogar über mehrere Tage hintereinander in jeder großen Pause, an der Wand stehen zu müssen, war, soweit ich mich entsinnen kann, das fragwürdige Privileg der Jungen. Das sah so aus, dass der Verurteilte zum einen nicht mit den anderen Schülern in der Pause herumlaufen konnte, weil er eben mit dem Rücken an der Wand des Schulgebäudes stehend deren Treiben nur als ausgeschlossener Zaungast verfolgen konnte. Zum anderen hatte dieses An-der-Wand-stehen natürlich in seiner Öffentlichkeit etwas Abschreckendes und Abstoßendes, nicht nur, weil die Bewegung des bestraften Kindes eingeschränkt wurde, sondern auch, weil der Übeltäter für alle sichtbar und allen zum Spott wie am Pranger stand. Es war stets der Übeltäter - es ist mir im Gedächtnis geblieben, dass Jungen für Vergehen unterschiedlichster Art an die Wand gestellt wurden. Im Nachhinein scheint es mir schwer vorstellbar, dass kein Mädchen sich jemals etwas zu Schulden kommen ließ. Ich schlug mich in der vierten Klasse ein einziges Mal auf dem Schulhof mit einem Jungen. Dabei ist mir weder die Ursache noch der Ausgang des Streits in Erinnerung. Nur einer Sache bin ich mir ganz sicher: Nämlich dass ich dafür nicht an der Wand stehen musste. Klar: Ein Mädchen schlug man nicht, selbst wenn es einen vielleicht zuerst geschlagen hatte. Wenn also jemand dafür an der Wand stehen musste, dann war das wohl der Junge.
Was in den siebziger Jahren, sobald ich eigenständig lesen konnte, nicht unbemerkt an mir vorüberging, war die Frauenbewegung. Warum das so war, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Meine Familie wohnte eher ländlich, in meiner Jugend kannte ich in Wesel-Flüren keine Feministin, die man, hätte ich eine gekannt, gewiss abfällig und verächtlich als Emanze bezeichnet hätte, natürlich nicht zuletzt, um so was ins Lächerliche zu ziehen. Meine Eltern führten - wie alle anderen Ehepaare, die sie kannten - eine traditionelle Ehe. Mein Vater ging morgens ins Büro, um am späten Nachmittag nach Hause zu kommen, während meine Mutter den Haushalt führte und meinen Bruder und mich betreute.
Ich las als Kind alles, was mir in die Hände fiel. Wenn die Erwachsenen sich anlässlich eines Besuchs bei der Oma am Kaffeetisch ungestört unterhielten, saßen mein Bruder und ich oft friedlich den ganzen Nachmittag im Nebenzimmer vor dem laufenden Fernseher. Während man uns gewissermaßen sinnvoll durch Zeichentrick- oder Westernfilme unterhalten glaubte, staunte ich über Schicksale und Unmenschlichkeiten, über die in der Neuen Revue, im Goldenen Blatt oder in Meine Geschichte berichtet wurde und die man mir vielleicht lieber im Alter von acht oder neun Jahren vorenthalten hätte. Zu Hause vertiefte ich mich in die Frauenzeitschrift Brigitte, welche meine Mutter in den siebziger Jahren abonniert hatte. Das Lesen der Rubrik Psychologie bereitete mir stets große Freude. Mit Begeisterung machte ich die Psychotests, die Selbsterkenntnis versprachen, und las über Eheprobleme und deren Bewältigung mit der Hilfe des Rats von Psychologen. Viel mehr hatte es mir aber die unter der Rubrik Freiheit der Frau angelegte halbe Seite mit dem Titel »Gleichberechtigung?« angetan. Der Titel Gleichberechtigung war in eine Zeile gedruckt, in der Zeile darunter stand ganz allein ein fett gedrucktes Fragezeichen, welches suggerierte, dass es mit der Gleichberechtigung wohl doch noch nicht weit her war. Auf dieser halben Seite befanden sich Zuschriften von Leserinnen, gelegentlich gar Lesern, die von ihren Erlebnissen im Alltag berichteten, welche in der Regel bewiesen, dass es eine Gleichberechtigung mit den Männern nicht im für Frauen wünschenswerten Maße gab - wodurch sich, meiner Ansicht nach, das Fragezeichen in der Überschrift erklärte und rechtfertigte.
Noch heute weiß ich, dass ich die Beiträge mit höchstem Interesse «««< HEAD regelmäßig gelesen und die von Frauen geschilderten Erlebnisse von
regelmäautoren: Jan Ulrich Haseckeßig gelesen und die von Frauen geschilderten Erlebnisse von
bootstrap Diskriminierung und Beleidigung mit heller Empörung und völligem Unverständnis für so viel Ungerechtigkeit zur Kenntnis genommen habe. Machten diese veröffentlichten Erfahrungen nicht jedem deutlich, dass Frauen zum Teil aus ganzen Bereichen des öffentlichen Lebens absichtlich ausgeschlossen wurden? Die Benachteiligungen von Frauen im Alltag drängten sich selbst einem Kind als unlogisch und nicht gerechtfertigt auf.
Mit acht oder neun Jahren mochte ich bei Erwachsenen keine Fehler und Unzulänglichkeiten wahrnehmen. Es waren schließlich Erwachsene, die mir als Kind Vorschriften machten, mir die Welt erklärten und ständig behaupteten, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass ich etwas nicht tun dürfe. Diese Menschen also, die mir als Kind alles verbieten durften und deshalb ja Vorbilder sein sollten, hätte ich mir gern als fehlerlos vorgestellt, um ihre Berechtigung, mich dauernd zu maßregeln und belehren, verstehen und anerkennen zu können. Kaum dass ich nicht nur Schreib-, sondern auch Druckschrift lesen konnte, hatten meine Eltern beginnen müssen, die Zeitung zu zensieren, indem sie Berichte über Gräueltaten und Grausamkeiten mit der Schere herausschnitten, weil ich, wenn ich dergleichen las, zu heulen begann. Die Gleichberechtigungsseite der Brigitte hingegen erzeugte in mir nichts als Zorn, denn sie kehrte die Fehler der Erwachsenen deutlich hervor.
Es war wirklich die nun ganz und gar nicht als revolutionär und hetzerisch bekannte Frauenzeitschrift Brigitte, die mir ein Bewusstsein schuf, dass es wohl nicht selbstverständlich war, gleichberechtigt zu sein. Ja, es schien doch sehr deutlich, dass es ein ziemlicher Nachteil war, bloß ein Mädchen zu sein, aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Aussicht, dass dies mit dem Älterwerden nur noch schlechter werden konnte. In meiner kleinen Welt hatte ich das nie so bewusst wahrgenommen. Tatsächlich hatte ich schon einmal davon gehört, dass es Mädchen gab, die zu Hause allen Ernstes die Zimmer ihrer Brüder aufräumen mussten. Zum Glück war mein Bruder ein Jahr jünger und einen halben Kopf kleiner als ich und hatte mir also nichts zu sagen! Überhaupt wurden weder mein Bruder noch ich zu irgendwelchen Hausarbeiten herangezogen, weil es meinen Eltern wichtiger war, dass wir unsere Freizeit in die sorgfältige Erledigung unserer Schulaufgaben investierten. Die Gleichberechtigungsseite der Brigitte rief in mir als Grundschülerin eine mehr als deutliche Ahnung hervor, ein Mädchen sei - zumindest aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit - wohl weniger wert als ein Junge. Gleichzeitig wuchs mein Unverständnis dafür, warum das eigentlich so sein sollte? Es konnte mir niemand diese Frage ernsthaft beantworten. Fortan begann ich, angestrengt im Alltag darauf zu achten, ob ich selbst wohl gleichberechtigt war, wobei ich immer wieder festzustellen meinte, dass dies zwar fast, aber niemals ganz der Fall war. Leider konnte mir kein Erwachsener einsichtig erklären, warum dies so seine Ordnung haben sollte.
Spätestens ab der dritten Klasse begann ich, auch in der Schule die Rolle der Frau in Frage zu stellen.
Auf der ersten Seite meines Zeugnisheftes der Grundschule war als Beruf des Vaters Fernmeldeingenieur vermerkt, bei »Beruf der Mutter« hingegen stand ganz schlicht »Hausfrau«. Ich wusste sehr wohl, dass meine Mutter eine Ausbildung als Sekretärin absolviert hatte, also über einen Beruf mit Bezeichnung durchaus verfügte und in diesem bis kurz vor meiner Geburt gearbeitet hatte. Die falsche Berufsbezeichnung fiel mir auf, und ich fragte meine Mutter danach. Dieser jedoch schien der Fehler nicht bedeutend genug, um daran etwas ändern zu lassen - nicht zuletzt war sie ja zu dem Zeitpunkt, als das Zeugnis ausgestellt worden war, Hausfrau gewesen.
Ebenfalls stellte ich fest, dass in meinem Zeugnis, das zum Beweis dafür, dass es zu Hause vorgezeigt worden war, unterschrieben werden musste, eine Spalte für die Unterschrift des Vaters oder des Stellvertreters vorgesehen war. Darüber ärgerte ich mich sehr. Ab dem
-
Halbjahr des vierten Schuljahrs ließ ich meine Schulzeugnisse mit Absicht ausschließlich von meiner Mutter, und zwar nicht nur mit ihrem Familien-, sondern auch mit ihrem Vornamen, unterschreiben und wartete gespannt - allerdings immer vergebens - darauf, dass, wenn ich es dem Lehrer so abgezeichnet zur Kenntnisnahme vorlegen würde, dieser sich provoziert fühlen und zu einer Äußerung hinreißen lassen würde. Wie gesagt, ich wartete stets vergebens, und ich bin nicht sicher, ob ich im Alter von neun oder zehn Jahren meinen feministischen Standpunkt überzeugend hätte vertreten können. Vielleicht dachte der Lehrer, mein Vater befinde sich häufig auf Geschäftsreisen, vielleicht war es ihm egal, vielleicht dachte er sich auch rein gar nichts dabei oder «««< HEAD begrüßte es sogar, dass meine Mutter die Zeugnisse unterzeichnete.
begrüautoren: Jan Ulrich Haseckeßte es sogar, dass meine Mutter die Zeugnisse unterzeichnete.bootstrap Gesagt hat er jedenfalls nie etwas. Wie hätte er auch sollen, denn immerhin war meine Mutter doch in der Tat “die Stellvertretende” meines Vaters. Und damit hatte schließlich, solange nicht ich meine eigene Unterschrift unter das Zeugnis setzte, alles seine Ordnung.
In meinem Grundschulzeugnis gab es auch eine Zensur in »Weibliche Handarbeit«, abgekürzt »Weibl. Handarb.«. Der Handarbeitsunterricht fand erst ab der vierten Klasse statt und wurde von einer älteren Lehrerin geleitet, die uns ebenfalls in Schönschrift unterwies. Weder die Lehrerin noch der Handarbeitsunterricht an sich sind mir in unangenehmer Erinnerung, durften wir Kinder doch in entspannter Atmosphäre dabei sogar auf unseren Tischen sitzen, was sonst in den Schulstunden niemals gestattet worden wäre. Es wurden zum Beispiel Topflappen gehäkelt, und wir lernten das Stricken. Was mich aber sehr aufbrachte, war, dass der Handarbeitsunterricht nach dem regulären Unterricht stattfand und allein für Mädchen eine Pflichtveranstaltung war, während die Jungen lediglich zur freiwilligen Teilnahme eingeladen wurden. Die Jungen durften also nach Hause gehen, während die Mädchen in so genannter weiblicher Handarbeit unterwiesen wurden. Mit Ausnahme eines künstlerisch begabten «««< HEAD Jungen, der regelmäßig zur Weibl. Handarb. erschien und schönere
Jungen, der regelmäautoren: Jan Ulrich Haseckeßig zur Weibl. Handarb. erschien und schönere
bootstrap Ergebnisse zeigte als die meisten Mädchen, nahmen die anderen Jungen verständlicherweise ihr Privileg, nach Hause zu gehen, in Anspruch. Verständlicherweise nicht nur, weil sie damit eine Stunde früher Schulschluss hatten, sondern auch weil der, der bei den Weibern blieb, dafür verhöhnt und verspottet wurde. Weiber war wirklich das Wort, das die Jungen zu jener Zeit in der Grundschule verächtlich zur Bezeichnung ihrer Mitschülerinnen benutzten und für das es damals noch nichts Vulgäreres gab. Der Junge, der am Handarbeitsunterricht teilnahm, musste also eine Menge Mut gehabt haben, um sich gegen die anderen zu stellen und zum Handarbeiten bei den Weibern zu bleiben. Vielleicht hätte ja der eine oder andere ganz gern Häkeln oder Stricken gelernt. Möglicherweise haben sich einige Jungen gleichfalls diskriminiert gefühlt, und zwar dadurch, dass sie sich erst gegen die Peergroup hätten stellen müssen, ihre Unmännlichkeit gegenüber den anderen Neun- bis Zehnjährigen hätten eingestehen müssen, bloß um eine an sich völlig geschlechtsneutrale Fertigkeit zu erlernen. So habe ich das damals natürlich nicht gesehen. Den einzigen Jungen, der zum Handarbeitsunterricht kam, verachtete ich dafür ordentlich, nicht allein wegen seiner vermeintlichen Unmännlichkeit, sondern einfach deshalb, weil er freiwillig länger in der Schule zum Unterricht blieb, obwohl er es nicht musste. Wir Mädchen hingegen wurden zum Bleiben gezwungen, was mich als Schülerin eben wegen der unleugbaren Ungerechtigkeit erbitterte und verdross. Da ich den Mut, den Handarbeitsunterricht einfach zu boykottieren, als gehorsames Kind nicht aufbrachte, erbat ich von der Lehrerin eine Erklärung dafür, weshalb die Teilnahme für Mädchen obligatorisch war, für Jungen hingegen nicht. Natürlich habe ich keine befriedigende, sondern nur eine ausweichende, immerhin aber nicht provozierende Antwort bekommen. Die Lehrerin meinte schlicht: Man lernt doch etwas dabei. Sie hätte durchaus sagen können: Das ist nun mal so. Oder: Weil ihr Mädchen seid und eines Tages einen Haushalt werdet führen müssen! Oder einfach: Frag nicht so dumm! Sei nicht so frech! Das war zu der damaligen Zeit oft die selbstverständliche Antwort gegenüber Kindern, deren Fragen man nicht beantworten wollte oder konnte.
Jedenfalls mochte ich die Lehrerin. Dass man etwas dabei lernte war unbestritten. Aber die weitergehende logische Frage, ob denn die Jungen dann wohl nichts lernen müssten, sparte ich mir, obwohl sie mich noch sehr lange beschäftigte und mich die klare Erkenntnis, dass ich wieder einmal nicht gleichberechtigt war, ärgerte. Ich wusste, dass man mir auf meine Frage keine befriedigende Antwort würde geben wollen und ich lediglich als äußerst renitentes freches Kind wahrgenommen worden wäre.
So war es jedenfalls, als ich im Rahmen der Gleichberechtigung beschloss, keine Röcke mehr anzuziehen. Natürlich trug man in den siebziger Jahren Jeans. Alle trugen Jeans, auch die meisten Mädchen. Aber im Sommer trugen bei uns die Mädchen damals, wenn es heiß war, Röcke und Kleidchen und keine kurzen Hosen. Ich aber setzte bei meinen Eltern sommerliche kurze Hosen durch, welche erheblich bequemer waren «««< HEAD und größere Bewegungsfreiheit bedeuteten.
und gröautoren: Jan Ulrich Haseckeßere Bewegungsfreiheit bedeuteten.
bootstrap
Ab dem dritten Schuljahr trug ich überhaupt keine Röcke mehr. Das Klassenfoto von 1976 zeigt mich in meiner Grundschulabschlussklasse, wieder im Sommer wie schon 1972. Obwohl ich hinten stehe und man das nicht gut erkennen kann, bin ich sicher, dass ich mit einer kurzen Hose bekleidet bin. Ich bin, wie man auf dem Bild deutlich sieht, nicht das einzige Mädchen, das eine kurze Hose trägt.
Als mein Bruder und ich im Sommer 1979 zur Firmung gingen, durfte auf Grund der Hitze mein Bruder eine kurze, ich hingegen musste eine lange Hose tragen. Wieder einmal war ich nicht ganz gleichberechtigt, aber dazu, einen Rock anzuziehen, ließ ich mich selbst für die Kirche nicht zwingen.
1976 wechselte ich die Schule und besuchte fortan das Städtische neusprachliche Mädchengymnasium mit Gymnasium für Frauenbildung in Wesel.
Meinem damaligen Verständnis nach ging es jetzt erst richtig gegen die Gleichberechtigung los. Allein die vermeintliche Notwendigkeit, dass Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet werden mussten, überstieg meine Vorstellungskraft. Dass auf dem Mädchengymnasium wiederum Handarbeit als verbindlich, später Hauswirtschaftswissenschaft - immerhin als Wahlfach
- auf dem Lehrplan stand, auf dem Jungengymnasium hingegen nicht, erhärtete meinen Verdacht, dass ich eine zweitklassige Ausbildung genießen sollte.
Meine Handarbeitslehrerin, welche uns Knopflöcher nähen ließ und uns sinnlose Tätigkeiten wie das Sticken von Tischdecken lehrte, mochte ich nicht. Mittlerweile war ich passive Verweigerin geworden, indem ich hinten im Handarbeitssaal meine Schulaufgaben erledigte und meine Mutter zu Hause die so genannten Werkproben anfertigte, welche ich zur gefälligen Bewertung an die Handarbeitslehrerin weitergab.
Ich war in der Grundschule gemischte Klassen gewohnt gewesen und wäre allein deshalb viel lieber meiner besten Freundin auf die Realschule gefolgt, wo Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet wurden. Mein Jahrgang war der letzte im Weseler Mädchengymnasium, der reine Mädchenklassen vorwies.
Im Jahr darauf wurde die Koedukation eingeführt, und das Mädchengymnasium musste endlich seinen Namen ändern.