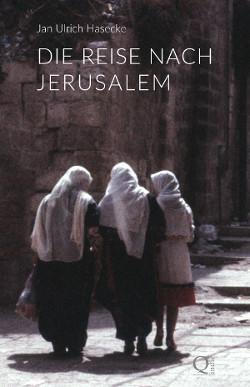Wir, meine Mutter, meine zwei Jahre jüngere Schwester (10) und ich, waren nach der Vertreibung aus unserer pommerschen Heimat im April 1946 und einer gar nicht lustigen Seefahrt von Stettin nach Travemünde auf einem ehemaligen deutschen Truppentransporter im Auffanglager Wimmersbüll bei Niebüll in Schleswig gelandet. Und bald fürchteten wir nichts so sehr, als unser weiteres Leben auf einer Sanddüne fristen zu müssen. Doch eines Tages hieß es, dass wir auf Dauer bei einer Familie im Dorf eingewiesen werden sollten. Erste Vorbereitungen wurden schon getroffen. Wir wurden wieder einmal neu registriert, und die Engländer in der Lagerverwaltung drückten Mutter sogar ein paar zerfledderte deutsche Banknoten in die Hand. Bevor wir aber unsere wenigen Habseligkeiten zusammensuchen konnten, gab es eine dicke Überraschung.
Am Vormittag vor der beschlossenen Einweisung betrat ein ungewöhnlich gut gekleideter Mann unsere armselige Barackenstube, elegant wie die Liebhaber in den Ufa-Filmen, die ich früher in dem einzigen kleinen Kino meiner Heimatstadt so gern gesehen hatte. Der Mann trug einen gelben Teddy-Mantel, einen hellbraunen Hut mit dunklem Samtband und spitze schwarze Schuhe, die blitzblank geputzt waren. Und er rauchte eine Zigarre! Unser Pritschennachbar bekam richtige Stielaugen. Meine Schwester Sibylle und ich kannten ihn nicht, besser gesagt, wir konnten uns zunächst nicht an ihn erinnern, denn wir hatten ihn mehrere Jahre nicht gesehen.
Es war Onkel Alfred aus Gronau in Niedersachsen. Der Luftikus und das schwarze Schaf in der Familie! Er trug immer noch den pechschwarzen Schnäuzer, der mich schon früher irritiert hatte, weil er dem des »Führers« so ähnlich sah. Gerade deswegen habe er sich ihn nicht abrasieren lassen, obwohl er ja Naziverfolgter gewesen sei, sagte er später, und das war bezeichnend für seine widersprüchliche Natur.
Bis heute weiß ich nicht, was ihn bewogen haben mag, die weite und damals äußerst beschwerliche Bahnfahrt bis in den hohen Norden Deutschlands zu unternehmen, nachdem er auf brieflichen Umwegen von unserem hiesigen Zwangsaufenthalt erfahren hatte. Vielleicht lag es daran, dass er plötzlich so etwas wie eine Familienverpflichtung verspürte. Wie ich aus dem Tratsch der Verwandtschaft wusste, hatte er früher meinen Großeltern ständig auf der Tasche gelegen.
Onkel Alfreds Lebensweg hatte mich seit jeher fasziniert. Teils hatte ich ihn bewundert, teils hatte er mir eher Angst eingeflößt. Er war gebürtiger Oberschlesier, lernte Kaufmann und diente, bevor er meine Tante heiratete, mehrere Jahre als Sekretär beim Fürsten Lichnowski in Berlin. Später wurde er Kartoffelhändler und investierte einige tausend Mark, die er sich von meinem Großvater geliehen hatte, in die falsche Knolle. In einer lauen Sommernacht des Jahres 1936, die in der Presse als »Schreckensnacht von Berlin-Lichterfelde« Schlagzeilen machte, schoss er, den Pleitegeier vor Augen, mit einem Revolver mehrere Löcher in die Daunendecken der Ehebetten. Die Federn stoben, meine Tante erlitt einen Ohnmachtsanfall, was die Geburt meiner Kusine Evelyn erheblich beschleunigte, und Onkel Alfred wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes inhaftiert und einige Wochen länger als nötig im Gefängnis behalten, weil er in seiner leicht aufbrausenden Art abfällige Äußerungen über die Nazis und ihr Rechtsempfinden gemacht hatte.
Einen gewissen Gerechtigkeitssinn konnte man ihm nicht absprechen. Er folgte diesem aber genauso ungestüm, wie er auf der anderen Seite, wenn sein Temperament mit ihm durchging, schnell ungerecht und verletzend werden konnte. Jetzt aber war er da, um sich um uns zu kümmern! Das begann gleich mit der Verteilung von Süßigkeiten an sämtliche Bewohner unserer Notunterkunft. Dann musste Mutter von unserem abenteuerlichen Leben unter den Russen und Polen nach der Besetzung unserer Heimatstadt berichten. Bald jedoch unterbrach er sie und begann, von sich zu erzählen. Er hörte nicht auf, bis wir in allen Einzelheiten wussten, welche Leistungen er nach Kriegsende vollbracht hatte. In dem kleinen Nest in Niedersachsen, in das ihn die Kriegswirren mit seiner Familie verschlagen hatten, hatte er sich als Kaufmann selbständig gemacht. Dabei war er, was man ja auch an seinem Äußeren sehen konnte, bereits gut ins Geschäft gekommen, wie es damals nur durch einen schwungvollen Schwarzhandel möglich war. Sein Erfolg war ihm nicht zuletzt dadurch erleichtert worden, dass er wegen seiner Inhaftierung durch die Nazis im Entnazifizierungsverfahren - für uns ein völlig neuer Begriff! - als »unbelastet« eingestuft worden war und gute Beziehungen zur Besatzungsmacht hatte anknüpfen können.
Unser trostloses Dasein in Wimmersbüll beeindruckte Onkel Alfred so nachhaltig, dass er beschloss, noch eine weitere Nacht im einzigen Gasthof des unwirtlichen Ortes zu verbringen, um uns am nächsten Morgen zur Einweisung in ein Bauernhaus zu begleiten. Dieser Vorgang führte dann zu einem seiner berüchtigten Temperamentsausbrüche, wobei uns die Frage, ob zu Recht oder Unrecht, diesmal völlig gleichgültig war. Die sich daraus ergebenden Folgen begrüßten wir jedenfalls uneingeschränkt: Wir kehrten nämlich Wimmersbüll und den Sanddünen für immer den Rücken, und das sogar, ohne im Besitz der absolut erforderlichen Zuzugsgenehmigung für einen anderen Ort zu sein!
Als Onkel Alfred den Verschlag unterm Dach gesehen hatte, der von nun an unser zu Hause sein sollte und durch den gerade der Altenteiler des Hofes zu seiner dahinter liegenden Schlafkammer schlurfte, und als er dann noch in der als gemeinschaftliche Küche dienenden Diele des Hauses über frei laufende Hühner und Kaninchen stolperte, brach es aus ihm heraus: Er beschimpfte die beiden sprachlosen Tommys, die uns mit ihren Gewehren Geleitschutz für den Fall etwaiger Feindseligkeiten der Ureinwohner geben sollten, als unmenschliche Besatzer und die schon vorher sprachlosen friesischen Bauersleute, ein verdrießliches älteres Ehepaar, als Parasiten. Dann trieb er uns aus dem Hause und sprang uns voran auf den klapprigen Lastwagen, der uns als letzte von drei Familien hier abgesetzt hatte. Bevor die verständnislos dreinblickenden Tommys nachkommen konnten, hatte er dem deutschen Fahrer zugerufen: »Zurück zum Lager!«, und dieser fuhr in dem Glauben, alles sei an Bord, ohne die Tommys los.
Als wir die Straßenkreuzung mit dem Wegweiser nach Niebüll, der Kreisstadt und Bahnstation, passierten, ließ Onkel Alfred anhalten, drückte dem verdutzten Fahrer ein paar Geldscheine in die Hand und zog uns von der Ladefläche des Wagens. Der machte kehrt und fuhr wieder zurück. Wir waren genauso verdutzt und wussten nicht, was das alles bedeuten sollte. Als Mutter endlich wagte, danach zu fragen, brummte Onkel Alfred kurz: »Ihr kommt mit nach Gronau, hier geht ihr mir ja vor die Hunde!«
Und dann marschierten wir los auf der Landstraße nach Niebüll. Nach kurzer Zeit begegneten wir einem überraschend freundlichen Schleswiger Bauern, der uns auf seinem Leiterwagen bis zum Bahnhof mitnahm. Zum Schluss sagte er, dass er Däne sei.
Auf welche Weise Onkel Alfred im einzelnen die Bahnfahrt organisierte, blieb mir schleierhaft. Wie wir später merkten, war er ganz groß im Organisieren. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Fahrkarten kaufte; unser Geld hätte jedenfalls nicht dafür gereicht. Auf dem Bahnhof herrschte ein einziges großes Durcheinander. Unzählige Leute drängelten sich mit Sack und Pack auf den Bahnsteigen und stürzten sich auf jeden einfahrenden Zug. Es war Montag, und Onkel Alfred sagte, es wären am Wochenende viele zum Hamstern aufs Land gefahren und hätten wohl am Sonntag keinen Zug mehr zurück bekommen.
Im Übrigen kam es mir vor, als ob die Züge nur fuhren, wenn sie Lust hatten; dann aber waren sie vollgepackt bis obenhin. Die Menschen hingen draußen auf den Trittbrettern und hockten sogar auf den Dächern! Onkel Alfred bahnte uns, nachdem wir mehrere Stunden hatten warten müssen, einen Weg bis hinein in ein Abteil. Er eroberte für sich und Mutter ein Stück Holzbank, und Sibylle und ich durften bei ihnen auf dem Schoß sitzen. Meiner Schwester half er dann, in das Gepäcknetz zu klettern, wo sie es sich bequemer machen konnte.
Der Zug fuhr nur bis Flensburg. Nach Hamburg würden wir heute nicht mehr kommen, sagte Onkel Alfred. So zogen wir im fahlen nördlichen Dämmerlicht zum Übernachten in einen Luftschutzbunker, der in der Nähe der Bahnhofs wie ein riesiger brauner Pilzkopf in den grauen Himmel ragte.
Es bot sich uns das übliche Bild, das uns schon von den vielen Flüchtlingstransporten geläufig war. Die Menschen saßen und lagen kreuz und quer auf dem kalten Steinboden der miefigen, düsteren Gewölbe. Onkel Alfred riet uns, dass wir wie die Glucke über ihren Kücken immer auf unseren Siebensachen hocken sollten, und drückte seinen eleganten Filzhut so zusammen, dass er ihn die Manteltasche zwängen konnte.
Am nächsten Morgen fuhr dann wirklich ein Zug nach Hamburg, in den wir mit viel Mühe eindrangen. Nach langem Warten auf zugigen Bahnsteigen ging irgendwann am Nachmittag die Fahrt von Hamburg weiter. Zusammengepresst wie die Ölsardinen dösten wir Stunde um Stunde vor uns hin. Dann wieder eine große Stadt, ein wüstes Trümmerfeld, die Bahnhofshalle ein fensterloses Stahlgerippe: Hannover.
Wir mussten noch einmal umsteigen, um einen Zug in Richtung Göttingen zu bekommen. Mutter und Sibylle waren schon auf ihren Rucksäcken eingeschlafen, als der Lautsprecher etwas Unverständliches schnarrte. Nur Onkel Alfred schien es verstanden zu haben und zog uns hoch. Es war schon dunkel, als wir in dem nicht so stark überfüllen Zug einen Platz gefunden hatten und uns auf etwas Schlaf freuten. Onkel Alfred sagte jedoch, dass wir jetzt aufpassen müssten, um nicht die kleine D-Zugstation zu verpassen, an der wir aussteigen mussten. Er scheuchte uns rechtzeitig auf, als der Zug, wie es mir schien, mitten auf der Strecke hielt.
Jetzt hatten wir noch eine dreiviertel Stunde Fußmarsch vor uns bis nach Gronau. Der Weg ging sofort in den Wald hinein und an einem kleinen Fluss entlang, der silbern im Mondlicht blinkte. Es hätte eine romantische Nachtwanderung werden können, wären wir nicht so erschöpft und kaum noch fähig gewesen, unsere Bündel zu tragen.
Endlich leuchtete nicht weit vor uns ein Licht auf. Onkel Alfred blieb stehen »Psst! Das ist die Schule, an der wir vorbei müssen, wo die Tommys ihr Hauptquartier haben. Ab neun Uhr abends ist Ausgangssperre für Deutsche. Wenn sie uns jetzt fassen, könnte es böse enden. Ihr habt keine Zuzugsgenehmigung und keine gültigen Papiere!« Wir gingen vorsichtig bis zum letzten großen Baum des Waldweges weiter. Vor uns an der Straße lag ein großes mehrstöckiges Gebäude, das taghell erleuchtet und von einem hohen Drahtzaun umgeben war. Dort patrouillierten zwei Soldaten mit umgehängten Gewehren auf und ab. Der Bürgersteig vor der Schule war vom grellen Scheinwerferlicht erfasst, aber auf der Straßenseite gegenüber standen einige dicht belaubte Bäume, die Schatten warfen.
Onkel Alfred kroch hinter eine große Kabeltrommel am Wegesrand, und wir watschelten geduckt im Entengang hinterher. Als die beiden Tommys die nächste Kehrtwendung von uns weg machten, hob Onkel Alfred den Arm. Ohne uns umzusehen, spurteten wir so schnell, wie es uns noch möglich war, über die Straße in den Schatten der Bäume.
Wir blieben schwer atmend stehen: Niemand hatte etwas bemerkt! Dann zogen wir weiter durch dunkle Gassen mit schiefen, sich aneinander drückenden Fachwerkhäusern, in denen nur wenige Fenster erleuchtet waren. Unter unseren Füßen glänzte Kopfsteinpflaster im Mondschein. Kein Mensch begegnete uns.
Dann quietschte ein Gartentor, und Onkel Alfred schloss mit einem langen Schlüssel eine schwere eisenbeschlagene Haustür auf. In dem gefliesten großen Treppenhaus hallte es laut wieder, ein schwacher Lichtschein fiel durch die Ritzen einer Wohnungstür im Parterre. Eine Frau im Bademantel öffnete auf Onkel Alfreds Klopfen: Das musste Tante Lotte sein! Ich weiß nicht, ob ich sie gleich wiedererkannte. Mir ist nur noch in Erinnerung, dass ich in einem riesigen Federbett versank und in einen ohnmachtähnlichen Tiefschlaf fiel.
So brachte uns ein Onkel mit überraschend gewecktem Familiensinn unverhofft an einen Ort, von dem wir nicht im Traum gedacht hätten, dass er für die nächsten Jahre unsere neue Heimat werden sollte. Der Ärger mit der fehlenden Zuzugsgenehmigung blieb natürlich nicht aus. Aber in Schleswig wollte uns niemand zurückhaben.