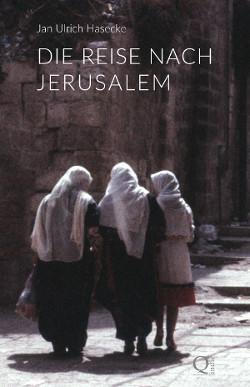Am 14. Mai 1940 wurde der Stadtkern Rotterdams innerhalb von zehn Minuten dem Erdboden gleichgemacht. Der Angriff der deutschen Luftwaffe war eigentlich nur ein Versehen. Denn aufgrund eines Kommunikationsfehlers war die Bereitschaft der Niederlande zu Kapitulationsverhandlungen nicht rechtzeitig weitergeleitet worden. So starben 900 Menschen aus Versehen, 80 000 wurden aus Versehen obdachlos, eine der schönsten historischen Hafenstädte wurde unwiederbringlich zerstört. An diesem Tag wurde ich geboren. Mein Leben begann in einem Krieg, dessen Folgen uns noch heute, sechzig Jahre danach, begleiten.
Ein Wahnsinniger hatte damit begonnen, Europa in Schutt und Asche zu legen. 55 Millionen Menschen sollten ihm zum Opfer fallen. Eine noch viel größere Zahl von Menschen wurde obdachlos.
Die Kinder meiner Generation wuchsen in einer entbehrungsreichen Zeit auf, und ich war keine Ausnahme. Später, als wir alt genug waren, über uns nachzudenken, wäre allerdings kaum jemand auf die Idee gekommen, sein persönliches Schicksal wegen der Kriegs- und Nachkriegsbedingungen lamentierend zu beklagen. Denn wir hatten keinen Vergleich mit anderen Schicksalen. Wir hatten alle das gleiche erlebt. Wir waren von unseren Müttern schreiend und widerstrebend in finstere Bunker geschleppt worden, und wir waren an der Hand unserer Mutter vor angreifenden Tieffliegern geflüchtet, die auf alles schossen, was sich bewegte. Wir kannten das drohende, heulende Geräusch der Jäger, die wie Wespen aus den Wolken niederstürzten und selbst dann, wenn man sie nur in der Ferne hörte, bei unseren Müttern Angst und Schrecken auslösten.
Die Nächte des letzten Kriegswinters hatten wir bei Kerzen- und Petroleumlicht im Gewölbekeller unseres Hauses verbracht. Fast jede Nacht ertönte mit heulenden Sirenen Fliegeralarm. Wir sahen am hell erleuchteten Himmel die Flugzeuge und hörten die Detonationen von Bomben und Geschossen. Wir flüchteten mit unseren Müttern in den feuchten, dunklen Keller, der in Wahrheit nur unzureichenden Schutz bot und zur tödlichen Falle werden konnte. Aber wir Kinder waren uns der drohenden, existenziellen Gefahr nicht bewusst.
Dennoch übertrug sich die spürbare Angst der Erwachsenen auf uns. Aber mehr noch als den Krieg fürchteten wir den gespenstischen Keller, der durch Kerzen oder Petroleumlicht nur spärlich beleuchtet war. Als der Krieg vorüber war, kamen unsere Väter nach Hause und versuchten ihr Trauma loszuwerden. Sie standen unter dem Schock, den ein martialischer, mörderischer Krieg bei ihnen ausgelöst hatte. Sie hatten bei ihrem sechsjährigen Feldzug durch Europa Tod und Schrecken über Millionen von Menschen gebracht und selbst den Tod gefürchtet. Sie waren hinter einer Feuerwalze durch zerstörte Städte gezogen, hatten Hunger, Kälte und Krankheit ertragen. Sie hatten erfahren müssen, wie wenig ein einzelnes Menschenleben wert war. Und so hatten sie nach und nach begriffen, wie bedeutungslos ihr eigenes Leben war. Nun begannen sie zu begreifen, dass sie nicht die Helden des gerechten Krieges waren, der ihnen eingeredet worden war, sondern die betrogenen Opfer eines gigantischen Verbrechens, Handlanger des größten Massenmörders, den die Menschheit jemals hervorgebracht hat. 55 Millionen Menschen waren ums Leben gekommen, und nun trugen unsere Väter dafür die Verantwortung.
Wie sollte das ein Sanitätsgefreiter verstehen, der gerade dem Tod entronnen war? Mit wem konnte er über sein unbewältigtes Trauma sprechen, das ihm nachts den Schlaf raubte? Er hatte seine Gesundheit geopfert, sechs Jahre seiner Jugend und seiner jungen Ehe. Er hatte seine Kinder nicht heranwachsen sehen und war ein Fremder, im eigenen Haus. Und nun bezog er Prügel von den Opfern, die überlebt hatten. Mein Vater starb 1956 an den Folgen, die der Krieg bei ihm hinterlassen hatte. Er war während des Krieges, während des ersten kalten Winters an der Ostfront schwer erkrankt. Eine Mandelentzündung hatte eine schwere Nierenerkrankung nach sich gezogen. Nun, im Dezember 1956, ließ er sich Gallensteine operativ entfernen. Nach wenigen Tagen versagten beide Nieren. Das war das Todesurteil. Es war das vorzeitige Ende eines Lebens, um das ihn das Tausendjährige Reich betrogen hatte.
Wie mein Vater mit seiner Rolle während des Naziterrors zurechtgekommen war, weiß ich nicht. Wir haben nie darüber gesprochen. Ich habe ihn nie danach gefragt. Auch später, nach seinem Tod, habe ich meine Mutter niemals nach dieser Zeit gefragt. Und von einer Ausnahme abgesehen, hat sie mit uns Kindern niemals über diese Zeit gesprochen. Sie waren keine Mitglieder der NSDAP, aber wahrscheinlich ließen sie sich während der ersten Jahre, wie viele andere, mitreißen. Es war ja alles besser geworden, als in den durch Inflation und Weltwirtschaftskrise gekennzeichneten zwanziger Jahren. Und ihr Führer hatte ihnen Milch und Honig versprochen. Das neue Medium Radio, von den Nazis geschickt eingesetzt, tat seine Wirkung. Auch das relativ neue Medium Kino wurde von den Nazis geschickt instrumentalisiert. Aber wie immer meine Eltern zu dem Regime standen, ganz sicher waren sie nicht an den Verbrechen der Nazis beteiligt.
Seit nunmehr fünfzig Jahren wird die Frage gestellt, warum die Generation meiner Eltern nichts gegen das Verbrechensregime unternommen hat. Ich werde den Versuch unterlassen, diese eminent wichtige und zugleich bornierte Frage zu beantworten. Stattdessen stelle ich, ohne einen Vergleich herstellen zu wollen, die Frage, was wir zur Verhinderung gegenwärtiger Ungerechtigkeiten und offensichtlicher Fehler zu tun bereit sind. Was taten wir zur Vermeidung von Tschernobyl. Verhindern wir wenigstens eine Wiederholung dieser Katastrophe? Was tun wir gegen die Überbevölkerung der Erde, was gegen den täglichen Hungertod unzähliger Menschen? Was tun wir gegen Ozonloch und Erderwärmung?
Wir müssen uns also fragen lassen, was wir zur Abwendung der Apokalypse beitragen, die der Menschheit droht, was wir für unsere Kinder und Enkel zu tun bereit sind. Mit den selbstgefälligen Forderungen grünalternativer Tugendbolde, die mit Vorliebe die anderen zur Pflicht rufen, ist es nicht getan. Die Frage ist, was wir konkret und rasch unternehmen. Wir kennen die Antwort nur zu gut: Wir tun nichts. Dabei könnten wir etwas tun, denn im Gegensatz zu meinen Eltern, leben wir in einer Demokratie, die unsere Aktivitäten nicht durch Strafandrohung und Terror behindert. Als die Nazis ihre Macht gefestigt hatten, war Opposition tödlich. Während wir heute wissen, welche Probleme uns bedrohen, wussten meine Eltern nichts von den Verbrechen, die das Naziregime beging.
Es ist heute, Jahrzehnte nach dem Naziterror, eine bequeme, selbstgerechte Lüge, zu behaupten, die Menschen hätten von der systematischen, organisierten Vernichtung von Juden gewusst. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wussten sie es nicht. Wir wissen vielmehr, dass die Nazis ihre Verbrechen geschickt zu tarnen wussten. Im letzten Kriegsjahr, als mein Vater zu einem seiner letzten Heimaturlaube zu Hause war, berichtete er meiner Mutter von einem Ereignis, das ihn in höchste Bestürzung versetzt hatte. Er hatte die Hinrichtung von einigen Zivilisten ansehen müssen. Die Männer wurden durch Genickschuss getötet und fielen in eine Grube. Er fragte ein Mitglied des Exekutionskommandos, was die Leute verbrochen hätten, denn mein Vater ging bis zu diesem Zeitpunkt offenbar sehr naiv von Recht und Gesetz aus. So konnte er sich nicht vorstellen, dass der Exekution nicht zumindest ein Standgericht vorausgegangen war. Wäre es so gewesen, hätte man ihm eine klare Antwort geben können, stattdessen erhielt er die sibyllinische Antwort: “Wenn Sie wüssten”. Mein Vater erfuhr dann doch einen Teil der Wahrheit, die wir heute kennen. Die Menschen waren Mordopfer der Nazi-Willkür.
Erst von diesem Moment an wusste mein Vater, dass etwas nicht stimmte, dass das Handeln der Nazis nicht im Einklang stand mit den großen und hehren Phrasen, die sie droschen. Das war ungefähr ein Jahr vor Kriegsende, also frühestens 1943. Als mein Vater dieses Erlebnis meiner Mutter berichtete, weinte er. In seiner Not beschwor er Gott, nicht zuzulassen, dass wir diesen Krieg noch gewinnen."
Wie groß muss seine Verzweiflung gewesen sein, seine Verwirrung, die innere Anspannung, angesichts des jahrelangen Drucks, dem er durch den Krieg ausgesetzt war. Wie groß war seine Enttäuschung angesichts des Verrates, der von den Inhabern der Macht an seinen Überzeugungen begangen worden war? Er hatte der Obrigkeit geglaubt, er hatte ihr vertraut.
Was ging in ihm vor, nachdem diese Erkenntnis in ihm reifte, der Krieg für ihn verloren war und er dennoch erneut an die Front musste? Was empfand er angesichts der wachsenden Angst, nicht nur um das eigene Leben: Seine Familie, die er alleine lassen musste, geriet in immer größere Gefahr. Die Front rückte näher. Der Luftraum gehörte bereits den Alliierten.
Mit uns Kindern konnte er in seinen wenigen, kurzen Heimaturlauben sicherlich nicht entspannt und geduldig umgehen. Die einzige Erinnerung, die ich aus dieser Zeit an meinen Vater habe, ist eine Ohrfeige, durch die ich vom Stuhl fiel. Ich habe das Bild der Küche in Erinnerung, den Tisch; ich weiß noch, wo mein Stuhl stand und auf welche Seite ich fiel. Ich weiß auch noch, in welchem Haus das war, in dem wir damals zur Miete wohnten. Ich weiß noch, in welcher Etage wir wohnten. Von meinem Vater weiß ich aus dieser Zeit sonst nichts: Ein fremder Mann, der mich ohrfeigte, weil ich ihm nicht gehorchte. In meiner saarländischen Heimat war der Krieg am 19. März 1945 zu Ende. Meine Eltern haben nie darüber räsoniert, ob das Ende dieses Infernos eine Niederlage war oder eine Befreiung, wie es heute gelegentlich geschieht.
Es war natürlich eine bedingungslose Kapitulation. Und die Menschen empfanden es so. Sie tanzten nicht auf den Straßen und begriffen langsam, dass dieser Kapitulation die Kapitulation der Zivilisation und der Menschlichkeit vorausgegangen war. Wenn die Deutschen heute, wie es einer Umfrage zu entnehmen war, den 8. Mai 1945 zu 80% als Befreiung und zu 20% als Niederlage empfinden, dann spiegelt dies das Empfinden einer anderen Generation in einer anderen Zeit wieder. Daran ist nichts auszusetzen. Es wäre schlimm, wenn es nach fast 50 Jahren Demokratie und Rückkehr der Menschlichkeit anders wäre. Das heutige Denken jedoch auf 1945 zu übertragen und heuchlerisch zu fragen, weshalb die Menschen damals so dachten, wie sie dachten, so handelten, wie sie handelten, ist dumm und arrogant. Die Menschen von 1945 hatten gerade damit begonnen, die mitverschuldete Katastrophe aufzuarbeiten. Und sie begannen, ihr Leben neu zu organisieren, ihre Existenz zu sichern.
*
Mein Vater kam bereits im Juli 1945 nach Hause. Er hatte, nach einem kurzen Fronturlaub seine Einheit nicht mehr erreicht, die irgendwo auf dem Balkan lag. Irgendwo im heutigen Slovenien oder Kroatien, war für ihn der Krieg zu Ende und er schlug sich zu Fuß, per Fahrrad und per Anhalter nach Hause durch.
Sein einfacher Dienstgrad und seine Zugehörigkeit zu einer Sanitätseinheit schützten ihn vor der Kriegsgefangenschaft. Die Amerikaner, die Bayern besetzt hielten, waren durch die große Zahl der deutschen Kriegsgefangenen ohnehin überfordert und ließen ihn ziehen. Auch die Franzosen, die inzwischen das heutige Rheinland/Pfalz und das Saarland besetzt hielten und alle intakten Rheinübergänge streng bewachten, hielten ihn nicht lange auf.
Ich war fünf Jahre alt, an jenem schönen Sonntagmorgen im Sommer 1945, als mein Vater zu Fuß die Straße heraufkam. Ich wusste sofort, dass es mein Vater war, obwohl er noch mindestens hundert Meter von mir entfernt war. Wir beide waren ganz allein. Es kam kein Auto. Die Menschen waren in ihren Häusern. Mein Vater trug einen hellen, leichten Leinenanzug, zerknittert und schmutzig. Auf dem Rücken trug er ein verbogenes Fahrrad. Er ging mitten auf der Straße und kam langsam auf mich zu, mit seinem müden, ernsten Gesicht, das ich immer klarer erkennen konnte. Je näher er kam, umso unsicherer wurde ich, und schließlich glaubte ich, er sei doch ein Fremder. Ich bekam Angst vor dem Mann, der mich nun anlächelte, blieb aber stehen. Dann, als er nur noch einige Meter von mir entfernt war, sprach mich der Mann mit meinem Namen an. Ich war verwirrt und lief weg. Er hatte mich erkannt. Das ist meine zweite Erinnerung an meinen Vater.
Ich schämte mich, ihn nicht erkannt zu haben, denn meine Mutter hatte unzählige Male von unserem Vater erzählt. Von der Freude, die wir alle empfinden würden, wenn er endlich für immer nach Hause käme, und dass dann endlich alles gut werde. Ich wusste nicht, wer mein Vater war. Ich wusste nicht, was ein Vater ist. Mich erfüllte seine Ankunft nicht mit Freude, bestenfalls mit Neugier. Er war ein Störenfried. Ich erkannte bald, dass dies keine unverbindliche Begegnung war, wie die mit einem Besucher, der irgendwann wieder ging. Hier war jemand, der von nun an entschied, was ich zu tun und zu lassen hatte. Er drang in mein Leben ein und forderte seinen Anteil. Wir Kinder mussten von nun an unsere Mutter mit ihm teilen.
Die Rolle des Störenfriedes wurde mein Vater in den elf Jahren, die er noch zu leben hatte, nicht mehr los.
Er war nach fünf Jahren zurückgekehrt zu seiner Familie, zu seinen Kindern, deren Fotos er in halb Europa mit sich herumgetragen hatte. Er hatte Demütigungen, Entbehrungen und Todesangst ertragen, ohne daran zu verzweifeln, weil er zu Hause seine Familie hatte, die er über alles liebte. Er hatte diesen Krieg nicht gewollt, er hatte nicht verstanden, weshalb dieser Krieg geführt wurde. Er wäre viel lieber zu Hause, bei seiner Frau und seinen Kindern gewesen. Aber sie hatten ihm gesagt, dass er für sein Vaterland kämpfen müsse.
So kam er, nachdem er in fünf Jahren an allen europäischen Fronten gekämpft hatte, niedergeschlagen, mit einem verbeulten Fahrrad auf dem Rücken und einer zerschundenen Seele nach Hause, zu seiner Familie, deren Fotos ihm geholfen hatten, zu überleben. Er hatte sich Trost erhofft.
Der Krieg hatte jedoch alle erfasst, nicht nur die Soldaten. Wie in keinem Krieg zuvor, war auch die Zivilbevölkerung betroffen gewesen. Und nun waren alle mit sich selbst beschäftigt. Natürlich wurden heimkehrende Soldaten freudig begrüßt. In unserem kleinen Ort kannten sich ja alle, und die Nachricht über die Heimkehr eines jeden Einzelnen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Begrüßungen waren freudig und herzlich, aber die Menschen gingen sofort wieder zu ihrer Tagesordnung über, denn sie waren müde. Und es herrschte Trauer über die vielen Gefallenen, die nicht mehr zurückkamen. Jede Familie hatte ihren Tribut gezollt.
Mein Vater verstand natürlich die anfängliche Scheu seiner beiden Kinder. Meine zweijährige Schwester gewöhnte sich schnell an ihn und zwischen den beiden entwickelte sich im Laufe der Zeit ein normales Verhältnis, während meine Distanz blieb. Die Seele meines Vaters blieb mir verschlossen. Er verstand es nicht, mir seine Zuneigung, seine Liebe zu zeigen. Heute weiß ich, dass er uns liebte. Ich begreife die Opfer, die er für uns gebracht hat und ich weiß, dass er gelitten hat unter der kriegsbedingten Trennung. Heute weiß ich sehr gut, dass er unter unserem Verhältnis litt, vielleicht auch unter seinem eigenen Unvermögen, dies zu ändern. Er trug die Schuld aber nicht allein. Meine Mutter schirmte uns Kinder, vor allem mich, mit ihrer behütenden Liebe wie eine Glucke von allem ab. Auch von unserem Vater. Wahrscheinlich stand sie oft, ohne es zu wollen, zwischen uns.
Auch ich war mitschuldig. Ich hätte, als ich älter war, viel mehr tun können, um meinen Vater an meinem Leben teilhaben zu lassen. Aber ich hatte ihn ausgeschlossen, bis zu seinem Tod. An seinem Grab empfand ich Trauer. Aber mehr als Trauer empfand ich Reue über meine Versäumnisse und Unterlassungen. An seinem Sterbebett hatte ich ratlos und hilflos gestanden. Ich ahnte, dass er sterben würde, aber ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich sah wie er litt. Er hatte sich binnen weniger Tage so sehr verändert, dass ich ihn zunächst kaum erkannt hatte. Im Stillen wünschte ich ihm Erlösung durch einen raschen Tod. Auch darüber empfand ich Reue, als wir an seinem Grab standen.