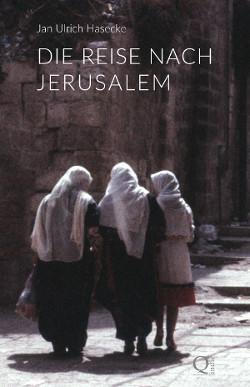Im Herbst 1945 begann ich meine Tätigkeit als Volksschullehrerin in einem pfälzischen Landkreis. Ich hatte ein paar Tage vor dem Eintreffen der Amerikaner gerade noch meine Ausbildung in der damaligen Lehrerbildungsanstalt mit dem 1. Examen abgelegt. Bis Ende 1944 hatte man sich zumindest in den ländlichen Gebieten bemüht, den Schulbetrieb wenigstens in den Volksschulen aufrecht zu erhalten, während die Oberstufen der Oberschulen bereits vollzählig zum »Schanzeinsatz«, also zum Ausheben von Schützengräben, eingezogen worden waren. Mit dem Eintreffen der Amerikaner, denen bald danach die Franzosen als Besatzungsmacht folgten, wurden im Frühjahr 1945 sämtliche Schulen geschlossen, die Abschlussklassen entlassen. Während dieser Zeit führte die Militärregierung sehr strenge Säuberungsmaßnahmen unter den Lehrern durch. Einige Wochen nach Kriegsende hatte ich mich in einer abenteuerlichen Fahrradtour (verbotenerweise; denn man durfte zunächst seinen Wohnort nur mit besonderer Genehmigung, die schwer zu erhalten war, verlassen) in mein heimatliches Dorf abgesetzt und wartete dort der kommenden Entwicklung. In unserm Landkreis wurden damals mehr als Dreiviertel aller Volksschullehrer vorläufig entlassen.
Ende 1945 rief der Schulrat alle verbliebenen Lehrer, dazu auch mich als Anwärterin, zu einer Konferenz zusammen, bei der die vorhandenen Stellen per Zuruf verteilt wurden. Die Kinder blieben in ihren bisherigen Klassen, neue wurden nicht aufgenommen, sodass vorläufig (bei damals achtjähriger Schulpflicht) nur sieben Klassen unterrichtet wurden. Trotzdem mussten fast alle Kollegen zwei oder gar drei Klassen übernehmen, damit alle Schüler wenigstens notdürftig versorgt waren. Schichtunterricht war daher unvermeidlich. Es ist mir bis heute schleierhaft, wie es überhaupt möglich war, die wenigen verbliebenen Lehrer auf den ganzen Landkreis zu verteilen.
Ich selbst wurde mit der Führung zweier Schulen in zwei gut fünf Kilometer auseinander liegenden Dörfern betraut. Am Vormittag unterrichtete ich in zwei Schichten die Kinder des einen Dorfes und am Nachmittag in dem andern, insgesamt vierzig Wochenstunden. Nicht nur die schulische Versorgung von über hundert Kindern in drei Schichten - einmal drei, einmal vier und im Nachbardorf gleich alle sieben Klassen gleichzeitig in einem Raum - war zu bewältigen; es kam ja noch der tägliche Weg dazu, den ich anfangs mit dem Fahrrad zurücklegte, bis die Bereifung einfach nicht mehr zu flicken war. Dann ging ich zu Fuß, bis auch das kaum mehr möglich war, weil die Schuhsohlen durchgelaufen waren. Und das im Winter!
Mein Antrag auf einen Bezugsschein für Sohlen wurde abgelehnt, weil ich die nötige Wartezeit noch nicht erfüllt hatte. Härtefälle wurden nicht berücksichtigt; also blieb nur der illegale Weg. Das hieß für mich, die Kinder zu bitten, mir ein halbes Pfund Butter zu besorgen. Dafür wollte sie der Schuster reparieren. Es war ja die Zeit, wo fast nur durch Tauschhandel oder auf dem Schwarzmarkt zusätzliche Wünsche erfüllt werden konnten. Ich erinnere mich noch heute, wie schwer mir das fiel als angehende Beamtin, die sich doch stets korrekt zu verhalten hatte. Aber der Schulbesuch ihrer Kinder war den Eltern so wichtig, dass ich wenige Tage später ein halbes Pfund Butter auf meinem Pult fand, zusammengelegt aus lauter kleinen Stückchen. Sogar ein paar Nägel hatten sie zusammengekratzt, so dass ich mir die Sohlen zusätzlich nageln lassen konnte, wodurch sie zwar um einiges schwerer wurden, aber viel länger hielten.
Unterkunft hatte ich bei einer sehr netten Familie gefunden, die mir jedoch kein heizbares Zimmer bieten konnte, sodass ich im Winter meine Vorbereitung für die Schule in der Küche, dem einzigen geheizten Raum des Hauses, durchführen musste, in dem auch die übrige Familie sich versammelte und sich oft sogar mit Nachbarn lebhaft unterhielt. So »erledigte« ich meine gedankliche Vorbereitung großenteils auf dem Weg.
Zum Glück hatte ich selbst eine einklassige Dorfschule besucht und konnte mich erinnern, wie es dort zuging. In Klassen mit mehreren Jahrgängen ist es nötig, einen Teil der Schüler still zu beschäftigen, während man mit einem andern direkt arbeitet. Aber wie beschäftigen? Lehrbücher gab es keine. Die alten waren verboten und neue noch nicht erschienen. Auch Schreibhefte gab es so gut wie keine zu kaufen. Die Kinder brachten an Papier mit, was sie zu Hause finden konnten. Auch Packpapier war darunter. Da es auch keine Schiefertafeln gab, auf denen sie wenigstens hätten üben können, suchten diejenigen, deren alte inzwischen zerbrochen waren, unter den Trümmern des von Bomben beschädigten Kirchendachs nach halbwegs ebenen Schieferplatten, die sie mit Bims- oder Sandstein notdürftig glätteten und in die sie oder ihre Eltern mit Nägeln Linien ritzten. Aber die zum Schreiben benötigten Griffel gab es ja auch nicht. Irgendwann stellte ein Kind fest, dass man das mit Alu-Stricknadeln Geschriebene wieder auswischen konnte. Seitdem schrieben fast alle damit, ein recht kümmerlicher Ersatz für die schreibentwöhnten Kinderhände.
Für die Schultafel standen nur ein paar alte Kreidestückchen zur Verfügung. Als auch die letzten Vorräte aufgebraucht waren, behalf ich mich mit Kalk, der sich aber nur schwer benutzen und fast noch schwerer wegwischen ließ. Da ich auch aus zeitlichen Gründen kaum mehr Aufgaben an die Tafel schreiben konnte und auch mein eigener Papiervorrat allmählich zur Neige ging, schnitt ich die leeren Ränder der Zeitung ab und schrieb auf diese Fetzen Rechenaufgaben, an denen die Kinder wenigstens etwas üben konnten.
Es war eine raue Zeit. Doch im Allgemeinen muss ich sagen, dass ich nie wieder so dankbare und lernwillige Schüler erlebt habe wie damals. Sie waren glücklich, wieder ohne Angst vor Tieffliegern zur Schule gehen, wieder lernen zu dürfen nach den überlangen Ferien. Viele von ihnen, vor allem die Bauernkinder, mussten auch jetzt noch nach der Schule tüchtig bei der Arbeit ihrer Eltern zupacken. Unvergesslich bleibt mir ein Zwölfjähriger, der allein mit seiner Mutter den elterlichen Bauernhof bewirtschaftete mit all der schweren körperlichen Arbeit, die damals dazu noch nötig war. Kein Wunder, wenn er gelegentlich im Unterricht einschlief!