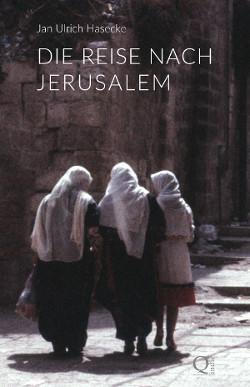Im Frühjahr 1945 kehrten wir in unser Heimatdorf zurück. Wir alle waren froh, dass das Haus noch stand. Etliche Granaten waren zwar eingeschlagen, aber das Dach war nur teilweise zerstört. Vater fand am nächsten Tag zufällig zwischen zwei zerschossenen amerikanischen Militärfahrzeugen ein paar noch gut erhaltene Autoabdeckplanen. Damit konnte er provisorisch die Löcher im Dach flicken, so dass es nicht mehr durchregnete.
Meine Mutter machte sich große Sorgen, wovon wir wohl in Zukunft leben sollten. Es gab nichts zu kaufen, denn der Bäckerladen war ausgebrannt und der Konsum ausgeplündert. Wie groß war daher unsere Überraschung, als wir sahen, was die Amerikaner uns hinterlassen hatten! Jede Menge Büchsen mit Brot, Zwieback, Schmalz und Schokolade, lagen überall herum. Besonders das schneeweiße Brot war für uns Kinder etwas ganz Besonderes. Wir staunten nur noch, was wir im Haus und im Garten alles zum Essen fanden. Wochenlang konnten wir davon leben. Meine Eltern versuchten, aus den halbwegs noch brauchbaren Möbelstücken, notdürftig die Küche und zwei Schlafzimmer herzurichten.
Voller Neugier schlich ich mich in den nächsten Tagen in die nähere Umgebung. Was gab es da nicht alles zu sehen! Einen ausgebrannten Jeep direkt hinter unserem Haus, eine von einer Granate zerfetzte Kuh auf der Nachbarwiese und jede Menge Munition. »Lass das Teufelszeug bloß liegen, wo es liegt!« Mein Vater war mächtig aufgebracht, als ich einmal stolz mit einer Kartusche ankam, die ich in Nachbars Garten gefunden hatte. Wie recht er hatte, erlebte ich einige Tage später. Fritz, mein Schulkamerad von nebenan, wollte mir stolz zeigen, wie man den Zünder von einer Granate abschraubt. Dabei explodierte das Geschoss und riss ihm die linke Hand ab.
Ein halbes Jahr später begann wieder der Schulunterricht in einem notdürftig hergerichteten Gaststättensaal. Der Lehrer, Herr Simonis, der gerade aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war, musste acht Klassen gleichzeitig unterrichten.
Ich weiß noch gut, dass anfangs nicht genügend Stühle und Bänke für alle Schüler da waren. Lehrer Simonis kam auf die Idee, dass die Klassen, die keine Schreibarbeit machten, still stehend, ein Kapitel aus einem Buch lesen mussten.
Vater hatte inzwischen zwei Kühe organisiert. Wenn ich aus der Schule kam und mit den Hausaufgaben fertig war, hütete ich sie auf der Wiese, die nicht weit vom Haus lag. Die Kühe gaben sehr viel Milch und meine Mutter machte Butter und Käse. Und da mittlerweile auch so einiges im Garten wuchs, brauchten wir keinen Hunger zu leiden. Auf den Bezugskarten gab es wenig an Textilien, und wer mehr haben wollte, musste es sich auf dem Schwarzmarkt besorgen. Meine Mutter hatte mit einem Händler im nahen Kreisstädtchen vereinbart, dass ich ihm einmal im Monat nachmittags zwei Pfund selbst gemachte Butter brachte. Dafür nahm ich dann mal Strümpfe, oder Handtücher und manchmal sogar Sachen für uns Kinder zum Anziehen mit. An eine Tour kann ich mich noch genau erinnern. Es war kurz vor Weihnachten, da setzte der alte Händler mir plötzlich, bevor ich ging, ein Tirolerhütchen auf. Mit trauriger Stimme sagte er: »Da! Das schenk ich dir.« Und mit Tränen in den Augen murmelte er: »Es gehörte meinem Enkel Tobi. Der ist beim Spielen mit einer Granate totgeblieben.« Ich bedankte mich und lief freudig nach Hause. Stolz zeigte ich das Tirolerhütchen meiner Mutter. »Dann hast du ja schon ein Weihnachtsgeschenk«, meinte sie. »Mehr nicht?« fragte ich enttäuscht. Da sah sie mich traurig an und schüttelte ihren Kopf. Ich ahnte, dass der Krieg zwar zu Ende war, aber für mich gab es wohl doch nicht mehr als nur dieses Hütchen.
Eines Abends unterhielten sich meine Eltern darüber, dass dieses Jahr wohl kein Weihnachtsbaum aufgestellt werden könnte. Rund um unser Dorf wären alle Wälder vermint und es sei zu gefährlich, einen Baum zu schlagen. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass wir Weihnachten ohne einen Tannenbaum feiern sollten.
Ohne zu Hause etwas zu sagen, schlich ich mich einige Tage vor Heiligabend heimlich mit einer kleinen Säge in der Hand, in den nahe gelegenen Wald. Als ich von einem Seitenweg aus in eine zerschossene Schonung hineinging, sah ich das große Schild mit der Aufschrift »Achtung Minengefahr!« Mein Vater hatte mir einmal gesagt, dass Minen hochgehen, wenn ein Mensch darauf tritt. Daraus folgerte ich, dass ich mit meinem Kindergewicht bestimmt keine Mine zur Explosion bringen würde. Als ich dann ein wunderschönes kleines Fichtenbäumchen vor mir entdeckte, da empfand ich keine Angst und sah auch keine Gefahr für mich. Vorsichtig kroch ich auf allen Vieren ein Stück näher heran und sägte es ab.
Stolz wollte ich es gerade aufheben, da spürte ich plötzlich, wie eine harte Hand mich von hinten packte. Erschrocken drehte ich mich um und blickte in das wütende Gesicht eines amerikanischen Soldaten. Dieser begann zu schreien und zu schimpfen in einer Sprache, die ich nicht verstand. Immer wieder zeigte er mit der Hand auf das Minenhinweisschild und redete ununterbrochen auf mich ein. Heute weiß ich noch ganz genau, welche Todesangst ich damals ausgestanden habe.
Ich stand regungslos da und starrte den Mann an. Als der Soldat dann schließlich zu seinem Jeep zurückging, da dachte ich nur noch, jetzt holt er eine Knarre und erschießt dich. Doch wie verblüfft war ich, als er mit vier riesig große Tafeln Schokolade zurückkam. Ich konnte es nicht fassen, was er jetzt tat. Mit Kordel band er die Schokolade an die Äste des Bäumchens fest. Schmunzelnd drückte er mir dann den geschmückten, kleinen Baum in die Hand. Bevor er mit dem Geländewagen davonbrauste, hörte ich ihn noch im gebrochenen Deutsch rufen: »Frohe Weihnachten!«
Wir haben zu Hause in den nächsten Jahren viele herrliche Weihnachtsbäume gehabt. Das geklaute Bäumchen von Weihnachten 1945 aber war und bleibt bis heute etwas Einmaliges.