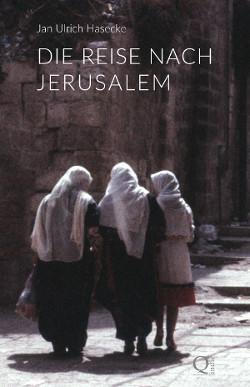Iversheim bei Münstereifel kurz vor Kriegsende
Kann man das Leben nennen, das wir hier führen, Anfang Februar 1945? Mit “wir” meine ich unsere übrig gebliebene kleine Familie: die Mama, den Hubert, unser Baby Brigitte und mich. Wir atmen noch in einem ständig von der feindlichen Artillerie beschossenen kleinen Dorf in der Voreifel. - Ja, Iversheim gibt es noch! In den verbauten engen kleinen Fachwerkhäusern ohne Kanalisation leben Menschen - an der Ley, eigentlich müsste es heißen “An der Erft”, denn diese plätschert ins Dorf hinunter. Eine Mauer und eine schmale Straße trennen das Flüsschen von den fast an den “Katzenberg” gelehnten Häuschen.
In einem dieser Häuser dürfen wir als Ruhrgebietflüchtlinge mit der Familie leben, die uns im Oktober vergangenen Jahres sehr freundlich aufgenommen hat. Hier auf dem Land sind wir sicher, haben wir gedacht. Pustekuchen! Jetzt im Februar 1945 atmen wir Pech und Schwefel ein. Wir leben hier rum und warten auf den Tod oder das Leben. Wie können wir uns vor dem Tod schützen in diesem Leben, das nur aus Tieffliegern, Bomben, Granaten und Artilleriebeschuss besteht? Das große abgestützte Loch, das die Familie in den Katzenberg gegraben hat, in das wir bei Herannahen der Tiefflieger stolpern und übereinander hängen, gekrümmt, damit der Luftdruck der Bomben unsere Lungen nicht zerreißt, kann uns auch nicht vor dem Tod schützen.
Ein längst verklungenes Versprechen der Erwachsenen steigt in mir hoch, unglaublich weit weg und bitter: »Der Krieg ist nach 14 Tagen beendet. Wir wollen “nur” unseren Korridor wiederhaben.« So sprachen Adolf Hitler und seine “Mannen” am 1. September 1939, als der Krieg ausbrach und unsere Soldaten über Nacht in Polen “siegreich” einfielen. War ich das Mädchen, das an dieses Versprechen geglaubt hat? Die Front wird niemals bis ins Herz Deutschlands vorrücken. Nun wissen wir, dass die Front immer weiter vorrückt. Der Westwall ist längst von den alliierten Truppen überrollt. Ich weiß, dass die Kinder in England singen: »We will hang our washing on the Sigfrid-line, have you any dirty washing mother dear?« Ich hasse sie hierfür. Schule ist schon lange nicht mehr. Aber das ist überall in Deutschlands so.
Wir leben nun hier in Iversheim bei Familie Hentz und sind in der irrigen Annahme hierher gekommen, auf dem Lande, da gibts keine Bombenangriffe und keinen Krieg. Nach mehreren Bombenangriffen und wiederholtem Ausgebombtsein, standen wir wieder mal, nachdem wir nach einem Bombenangriff aus dem Bunker gekrochen und durch die brennenden Straßen gelaufen waren, vor den rauchenden Trümmern unserer Bleibe. Ein Militär-LKW brachte uns auf die chaotischste und gefährlichste Art und Weise hierher in Sicherheit. Zu unseren Großeltern, die uns stets den Ort des Friedens und Geborgenseins in ihrem Haus in Essen auf der Margarethenhöhe vermittelten, konnten wir nicht mehr. Man hat sie in einer Plane auf dem Heldenfriedhof begraben. Ein Volltreffer zerstörte sie und ihr Haus. Ich will mich jetzt nicht weiter darüber auslassen. Doch: In den folgenden Jahren habe ich immer nachgerechnet: Wie alt wären sie jetzt …, wie alt wären sie jetzt …? Erst nach vielen Jahren habe ich aufgehört zu rechnen.
Im Augenblick haben wir aber Februar 1945. Wir sind der Front und dem Luftterror total ausgeliefert. Das Hämmern und Dröhnen in der Luft gehört zu unserem Alltag. Dem ständigen Näherrücken der Front müssen wir ohnmächtig entgegensehen. Wir leben im Krieg, wir leben mit ihm, und er lässt uns nicht mehr los. Kinder des Krieges, Kinder der Angst. Feuer lodert in unseren Kinderherzen, entzündet (so meinten wir damals) durch die grausame Unfähigkeit unserer Soldaten, das Unheil, das sich immer mehr auf uns zuschiebt, abzuhalten. Mit Macht drängt die Westfront zurück. Offensive? Ja, aber umgekehrt. Wir leben in einer Ekstase, die nicht mehr zu steigern ist. Unser Leben, unsere Herzen, die durch all unsere Schrecken noch vorhanden gebliebene Harmonie überschlägt sich in schrillen Dissonanzen. Die Saiten sind überspannt. Sie können in jedem Augenblick zerspringen. Ekstase!
Wir Kinder riechen Blut und Pulver. Die Jungen, mein Bruder Hubert und sein Freund Hans Hentz, der Sohn des Hauses “An der Ley 140”, tragen stolz gefüllte Pistolentaschen in der großen Volkssturmuniformmanteltasche. Es sind alte SA-Mäntel, die ihnen der Volkssturm verpasst hat. Radios gibt es in den Haushalten nicht mehr. Auf Veranlassung des Ortsgruppenleiters mussten diese zur Sammelstelle im Dorf, der ehemaligen Volksschule, gebracht werden.
Und woher haben unsere Mütter ihre Informationen? Von den Soldaten, die sich von der Front zurückziehen und die Straßen und Feldwege entlanggehen. Denn die Bahnstrecke am Rande des Dorfes, die ständig von Tieffliegern bombardiert wird, ist zerstört und stillgelegt. Humpelnde, blutige Soldaten, gesunde Soldaten, Autokolonnen, alle ziehen sich von der Front zurück, die wie ein Raubtier darauf lauert, zum letzten Sprung anzusetzen. Und in der Luft fliegen die stählernen und doppelleibigen Raubvögel und treiben mit uns Hasenjagd. Ein wüstes Drauflosleben herrscht im Dorf. Die Frauen, deren eigene Männer an irgendeiner Front kämpfen, lieben fremde Soldaten, die in den Häusern festes Quartier bezogen haben. Des Nachts singen, trinken und tanzen sie. Frau Hentz hat keine Einquartierung, sie hat unsere kleine Familie aufgenommen. Die von der Front zurückflutenden Soldaten müssen laut Befehl im kalten Winter in den Häusern Unterschlupf finden. Auch bei Frau Hentz liegen sie auf dem Steinfußboden im Flur, um am nächsten Morgen weiterzuziehen. Raureif und Schnee zeigen mitunter morgens, dass viele Landser draußen auf der kalten Erftmauer übernachten mussten. »Mein Gott«, hör ich Mama sagen, »warum macht der Führer nicht Schluss? Es ist nichts mehr aufzuhalten!«
»Halt den Mund, Anna«, sagt Frau Hentz, die Mamas Freundin geworden ist, »willst du eingesperrt werden?«
Wenn wir was zu essen einkaufen wollen auf unseren Lebensmittelkarten, stehlen wir uns abends nach Münstereifel über die dunkle Landstraße wie Diebe. Auf dem Weg dorthin liegt etwas abseits der Straße kurz hinter Iversheim die gefürchtete “Hettners” Fabrik. Ein beliebtes Bombenziel der Tiefflieger und Lightlings. In Friedenszeiten war Münstereifel ein Kneippkurort! Was ist das - Friedenszeit? Um 6 Uhr abends haben die Geschäfte für eine Stunde geöffnet, wir müssen uns dann sputen. Manchmal gehen Mama und Frau Hentz die dunkle von Wehrmachtsfahrzeugen befahrene Chaussee entlang, hin und wieder gehen auch Marianne und ich. Marianne ist meine Freundin und wohnt mit ihrer Mutter und ihren erwachsenen Schwestern im Haus nebenan. Ich bin froh, dass ich sie habe. Wir sind gleichaltrig. Die Jungen brauchen nicht einzukaufen. Sie müssen ständig im Einsatz sein der Suche nach Deserteuren. Kurz hinter dem Dorf verläuft ein Wäldchen neben der Hauptstraße. Dort begegnen uns keine zurückflutenden Wehrmachts-LKW. Viel zu schnell befinden wir uns wieder auf der Hauptstraße. Eng an den Straßensaum drängen wir uns, damit uns die abgeblendeten Wehrmachtsautos nicht überrollen. Und über uns brummen die Bomberverbände, die Tiefflieger, und hin und wieder zischt auch eine Granate über unsere Köpfe hinweg. Und wir hüpfen im Dunkeln wie gejagte Hühner in die ausgeworfenen Deckungsgräben, in denen sich kaltes Wasser angesammelt hat und rennen weiter, wenn sich die Motorengeräusche wieder entfernt haben. Unsere Zähne klappern, und klatschnass sind wir. Wir watzen, rennen und marschieren, nur als Schemen sichtbar, die Straße entlang, tauchen wieder unter in einen der nächsten Gräben, flattern weiter an Autos vorbei, die angehalten haben, deren Fahrer und Soldaten auch vor den Granaten und Tieffliegern Deckung nehmen bzw. genommen haben. Würde uns ein Mensch aus einer friedlich gewordenen Zeit beobachten, sein Kinderglaube an Gespenster würde in ihm erwachen. Wir sind aber keine Gespenster. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Nicht jedes Mal haben wir Essbares in unseren Taschen, und die ganze Prozedur war für die Katz.
Bei Marianne bin ich oft. Ich schlafe dort. Ich habe dann nur die zusätzliche Angst, dass wir nicht zusammen sterben, meine Familie und ich, wenn es nachts losgeht. Im Übrigen geht trotz allem oder gerade deshalb unten im Haus “die Post ab”. Marianne und ich liegen im Bett und ihre schon erwachsenen Schwestern feiern lautstark mit den Soldaten. Und wenn ich nachts zum Plumpsklo über den kalten manchmal verschneiten Hof marschieren muss, sehe ich auch, dass sie sich küssen. Jeder Tag kann der letzte sein.
Ich habe den Eindruck, dass in Iversheim nur arme Menschen vom Lande leben. An einem Handtuch trocknet sich die ganze Familie ab. Kanalisation gibt es hier an der Ley nicht. Das Schmutzwasser wird einfach in die Erft über die Mauer gekippt und auch die Nachttöpfe werden so geleert. In den Plumpsklos hängt an einem Nagel an der Holztür mit dem Herzchen in Stücke geschnittenes Zeitungspapier.
Flucht
Ich möchte über den Sternen schweben und mit all dem hier nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, die wir im Februar 1945 hier leben. über den Sternen durch die stillen blauen Gänge wandeln, uns bei den Händen halten und den Papa, der irgendwo Soldat sein muss, in unserer Mitte haben. Die Flugzeuge sind dann so tief unter uns, dass wir sie gar nicht mehr sehen können und auch nicht hören. Wir wissen gar nicht, dass es sie gibt. Ist das nicht fein? Tief atmen, kein Schwefel, kein Verderben mehr. Aber - wir müssten erst tot sein. Und das wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Das ist doch das einzige, was wir noch tun können, dem Tod so gut es geht davonzulaufen. Das bisschen Schlaf, das uns manchmal nachts zwanghaft überfällt, entspannt nicht mehr. Wir schlafen ein vor Übermüdung und Erschöpfung. Im Halbschlaf, im Wachen und im Träumen fegen die Granaten übers Dorf hinweg, und viele Granaten schlagen im “Katzenberg” ein. Ich schlafe wieder mit Mama zusammen und bin nur noch tagsüber bei Marianne. Das Wissen, dass wir vielleicht gar nicht mehr aufwachen, ist schlimm. Und das Rumoren der schweren Bomberverbände, die das Ruhrgebiet anfliegen oder Mitteldeutschland, brummt in unseren Köpfen wie das ewige Bohren beim Zahnarzt. Die Nerven müssten längst abgetötet sein. Sie sinds aber nicht.
Schaut her, ihr Leute aus einer anderen Zeit, die da kommen wird, aus der Zeit des Überflusses, aus der Zeit, in der ihr euren Genuss schätzt, seht sie euch an, die müden Wanderer, die schon wieder einmal flüchten, rennen und bangen um ihr bisschen nacktes Leben. Ich hör’ euch aus der Zukunft rufen und höhnen, ihr, die ihr in euren teuren Luxusautos an uns vorbeifahrt. Die schemenhaften schäbigen Menschen am Straßenrand, was sind (waren) sie schon? Sind sie euch lästig? Ach was. Ihr sagt dann nur: »Selber schuld, warum habt ihr alles mitgemacht?« Aber wir sind jung und wollen nicht sterben. Ich bin 13 Jahre alt. Schule ist nicht. Wir leben im Krieg und können uns in eure Epoche nicht hineinversetzen, in der ihr nach verdammt langer Zeit ohne Todesangst, ohne Hunger, gut gekleidet und im Überfluss leben dürft.
Sinnlose Flucht
Die Chaussee ist alt, verbraucht und ausgefahren von den vielen schweren Wehrmachtslastwagen. Der kleine Flüchtlingstrupp bewegt sich diese Straße entlang. Wir sind die Einzigen und Letzten, die heute Morgen das Dorf verlassen. Während der vergangenen Wochen sind Menschen ausgezogen. Aber viele Kleinstbauern bleiben auf ihren Höfen, wenn, ja wenn sie nicht ein zu hohes Parteimitglied sind. Aus fünf, nein sechs Personen besteht unser kleiner Treck, wenn man den Einheitskinderwagen mit Inhalt dazurechnet, der sich von Iversheim nach Münstereifel schieben will. Meine Freundin Marianne ist zuhause geblieben. Ich habe mich nicht einmal mehr von ihr verabschieden können. Es ist beschlossen worden, dass wir versuchen wollen, nach Bayern zu kommen. Dieses Stückchen Deutschland liegt abseits des Kriegsgeschehens - heißt es. Es ist heute ein eisig kalter, noch von den letzten Schleiern verhängter Februarmorgen. Wie immer - wann war es mal anders? - rauscht und zischt es in der Luft von Artilleriegeschossen über die Köpfe der aufgebrochenen armseligen mit Sack und Pack behafteten Wanderer hinweg.
Wir sind die Wanderer. Frau Hentz mit ihren zwei Jungen, Mama mit Hubert, mir und dem Baby im Einheitskinderwagen. Wir befinden uns sozusagen im Niemandsland, und wenn wir’s nicht besser wüssten, eigentlich schon hinter der Front. Wir zucken immer noch zusammen bei den gewohnten harten im Kopf wehtuenden Geräuschen in und aus der Luft. Aber eine natürliche Angst können wir nicht mehr empfinden. Aus einer gewissen inneren Gewöhnung heraus besitzen wir nicht mehr die seelische Kraft, ungezwungene Angst zu verspüren. Die große kräftig gebaute Frau mittleren Alters in dem abgewetzten ehemals grünen Lodenmantel ist Frau Hentz. Sie trottet keuchend, ein schweres Bündel auf der Schulter tragend, wie der Packesel einer Gesellschaft, auf der Landstraße daher. Sie will aber wirken und trägt sehr eindrucksvoll das große Bündel. Sie ist tatsächlich die Stärkste und Rüstigste in unserer jämmerlichen Gruppe. Wie hat sie sich damit gebrüstet, dass sie als Frau bei den Bauern schwerere Säcke tragen kann als die Männer. Heute früh beim Abgang hat sie sich fast darum geschlagen, das schwerste Bündel zu tragen - beim Verlassen des verbauten kleinen Fachwerkhauses an der Erft. Das Hoftor hat sie noch sorgfältig abgeschlossen. In diesem Haus, das der Mama und uns Kindern eine kurze Zeit als Domizil diente, war in den letzten Monaten der Todesangst und Todesgefahr eine herzliche Notgemeinschaft entstanden, zwischen den beiden unterschiedlichen Frauen sogar eine feste Freundschaft.
Es geht weiter in die nächste Ungewissheit. Aber es ist so. Frau Hentz entzieht sich mit ihrem Gekeuche jeder weiteren verantwortlichen Aufgabe. Sie schimpft nur hin und wieder, dass der Sack auf ihrer Schulter schwer ist. Die Mama trägt auch zwei große Koffer an ihren zarten Handgelenken, die schon geschwollen sind. Unsere Mutter wirkt auch jetzt noch wie eine Dame in Urlaub. Es sieht so aus, als habe sie trotz aller Mühe keinen Gepäckmann erwischt und muss nun ihre Koffer selbst tragen. Der schwarze breitkrempige Filzhut mit der Goldspange vorne sitzt gut auf ihren schwarzen Haaren. Mama ist sehr heiser. Der Husten von vor Weihnachten hat sich in einen bösartigen Katarr verwandelt. Sie krächzt unter großer Anstrengung über die Landstraße:
»Pass doch auf, geh an den Straßenrand, lauf nicht unter ein Auto!« Dabei wirkt die Straße fast geisterhaft. Der kleine schlaftrunkene Heinz Hentz ist gemeint, der als einzigen Ballast ein leeres Kochgeschirr mit seiner Hand hin- und herschlenkert und natürlich eine Soldatenmütze seinen Kopf ziert, deren Ohrenklappen heruntergezogen sind. Seit einigen Tagen friert der Heinz am Kopf sehr. Als Frisur trägt er “Glatze mit Spielwiese”. Ein verlassenes Büschel Haare vorn über der Stirn ist nach dem Kahlschlag übriggeblieben. Aber so macht er am ehesten den Kopfläusen den Garaus. Auch ist es nichts Besonderes oder gar Schlimmes, Kleiderläuse zu haben. Die zurückflutenden Frontsoldaten, die Zivilbevölkerung in ihren Häusern übernachten lassen muss, haben diese widerlichen Tierchen eingeschleppt. Da hilft kein Bügeln, kein Wäscheauskochen, nichts - nichts - nichts. Und erst recht nicht die paar Gramm Waschpulver, die im Monat auf den Lebensmittelmarken fällig werden!
Frau Hentz schreitet kräftig aus. Wir hinterher. Die aufgehende Sonne hat inzwischen den letzten Schleier der Nacht von diesem unserem Bild entfernt und zeigt nun ein blutrotes, aber eisig kaltes Gesicht. Mir fällt das Reiterlied ein: “Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod.” Das Lied fügt sich gut ein in das Geschehen. Abgeschossene, entwürdigte Baumkronen liegen im Straßengraben. Restliche feuchte Nebelfetzen steigen auf aus den bereiften winterlichen Weiden, auf denen längst kein Vieh mehr grast. Unsere Hände sind kalt und klamm, und die Feuchtigkeit dringt durch unsere spärliche Bekleidung. Wir spüren die geballte Faust der Front, die sich nur noch zum letzten Würgegriff zu öffnen braucht. Aber gerade diesem Griff wollen wir entgehen. Darum bewegen wir uns wie die Marionetten auf der Landstraße voran. Wehrmachtsautos begegnen uns nur noch sehr selten. Was Räder und Füße hat zum Laufen, ist längst über alle Berge. Da singt Hubert, mein etwas älterer Bruder, lautschallend los:
»Morgenrot, Morgenrot, leuchtest uns zum frühen Tod. Bald wird die Trompete bla-a-a-sen, dann muss ich mein Leben la-a-a-ssen, ich und alle dann mit mir!« Ist das Gedankenübertragung?
»Junge, sei still!« lässt Mama sich krächzend vernehmen. Umgedichtet hat er auch noch!
»Verdammt noch mal«, sagt da der Hubert. Und wir alle zucken unwillkürlich zusammen, als wieder Granaten ganz nah über unsere Köpfe hinwegzischen und irgendwo in Iversheim einschlagen. Wir halten uns im so genannten toten Gebiet auf, im Niemandsland, ohne deutsche Truppen, aber schon auf Nummer sicher für die anderen, für die Alliierten.
»Mam, ich sin bang!« ruft der kleine Heinz. Den Kinderwagen mit meiner kleinen Schwester Brigitte schiebe ich. Das Baby schläft, warm eingepackt liegt es im engen mit Holzbrettern verlängerten Einheitskinderwagen. Meine linke Hand umfasst den Kinderwagengriff, und mit der rechten trage ich eine große schwere Tasche. Die beiden großen Jungen, mein Bruder Hubert und Hans, der ältere Sohn von Frau Hentz, sind mit wenig Gepäck belastet. Die schwarze lederne Pistolentasche hängt nun dick und mächtig auf dem Koppel von Hans schweren braunen Volkssturmmantel. Er ist von der Wichtigkeit seiner Waffe überzeugt. Zudem ist er schon 16 Jahre alt und hat mitgeholfen, den Westwall aufzubauen, der längst von den Alliierten überrollt worden ist. Die Jungen möchten so gern Helden sein. Wir betreten die schmale Brücke, die kurz hinter Hettners Fabrik über die Erft führt und ahnen nicht, dass unsere Soldaten bereits eine Sprengladung unter die Pfeiler gelegt haben, damit die feindlichen Panzer in die Luft fliegen. Und noch auf der Brücke bleibt Frau Hentz stehen, hält sich fest am wackeligen Geländer, wirft ihren Packen von der Schulter, zieht sich den selbst gestrickten roten Fausthandschuh aus (ich habe ihr noch gezeigt, wie man den Daumen strickt!) und wischt sich mit dem bloßen Handrücken den kalten Schweiß von der Stirn. Wir machen alle Halt. So kalt, dass die fließende Erft zugefroren ist, ist es nicht. Hubert spuckt ins Wasser und guckt der enteilenden Welle nach.
»Die fließt jetzt noch die Ley in Iversheim runter«, meint er.
»Du bist ein Ferkel, Hubert.«
»Weiter, weiter«, krächzt Mama, »es hat keinen Zweck, jetzt schon müde zu werden. Wir wollen doch nicht von einer Granate getroffen werden!«
»Kumm, Mam, isch tragen der Packen«, bietet sich der große Hans nun an.
»Ne, lass nur Jung, ich mach das schon.« Hau ruck, die gefüllte und verschnürte Wolldecke lastet auf den breiten Frauenschultern. Die winzigen eirigen Räder am Kinderwagen quietschen. Der kleine Heinz Hentz und ich gehen neben meiner Mama weiter. Hans und Hubert schwingen ihr Handköfferchen und reden eifrig miteinander. Von Iversheim bis Münstereifel sind’s drei Kilometer. Die erste Etappe auf unserem gefährlichen und ereignisreichen Weg nach Bayern zu unseren Verwandten
Frau Hentz mit ihren zwei Jungen hat sich uns nur angeschlossen, weil sie wegen ihrer Zugehörigkeit zur NSDAP Muffensausen hat. Und wir hauen mal wieder ab - diesmal aus der Schusslinie der Westfront. Sie hat sich in der kurzen Zeit, in der wir hier leben, mit Riesenschritten auf uns zubewegt. Unser Vater hat in seinen Feldpostbriefen von uns verlangt, nach Niederbayern, Fürstenzell bei Passau, abzuhauen. Woher sollten wir damals wissen, dass es besser gewesen wäre, sich wie viele andere Zivilisten im Haus zu verstecken und alles auf uns zukommen zu lassen? Das “Gelobte Land” wartet auf uns. Herr Hentz ist Soldat an der Ostfront. »Lasst uns net alleen he!« bat Frau Hentz unsere Mutter, als diese verkündete: »Wir hauen ab nach Bayern!«
An einem eisig kalten Wintermorgen im Januar haben wir in aller Herrgottsfrühe den Opa von Hentz zu Grabe getragen. Die Kirchenglocken läuteten in der Finsternis, denn am Tage, wenn es hell war, wurde nicht mehr beerdigt. So bewegte sich der Trauerzug die schmale Ley entlang bis auf den Friedhof hinter der Kirche. Das zarte Kling, Kling der Glöckchen, die die Messdiener trugen, war ein bisschen Balsam für unsere müden Herzen. Der arme Opa! Jetzt ist er tot! Als wir in Iversheim Unterschlupf fanden, nach dem letzten Ausgebombtsein in Bochum, war der Opa noch sehr rüstig. Er hatte Krebs. Wieder ein Mensch, den wir kannten, wurde begraben. Aber er war an einer Krankheit gestorben. Zu Hause im Ruhrgebiet wurden die Toten massenweise in Feldplanen in Heldengräber gebettet zwischen Fliegeralarm und Bombenabwürfen.
Münstereifel ist von den Bomben, die die Tiefflieger ausgeklinkt haben, nicht verschont geblieben. Wir passieren noch in der Frühe das heil gebliebene schmale Stadttor, das in Friedenszeiten ein beliebtes Postkartenobjekt war, an dessen rotbraunen zusammengemauerten Ziegelsteinen jetzt Panzerfäuste lehnen. Wir sind froh, dass wir endlich den Sammelplatz, den Bunker, ansteuern können. In der Luft stürmen sie wieder heran, die großen stählernen Vögel. Wie viele Luftkämpfe haben wir schon in der Vergangenheit mit unseren Augen verfolgt. Kondenzstreifen am Himmel. Das war jedes Mal ein großartiges Schauspiel für uns.
»Mensch, Hubert«, sagt der Hans begeistert, »lurenz, davon möchte ich auch eine abziehen.« Er meint die Panzerfäuste. Zwei Paar Bubenaugen werden heiß. Und vielleicht sehen sie sich im Geiste feindlichen Panzern entgegenlaufen, oder sie robben auf dem Bauch heran, um eine heldenhafte Tat vollbringen zu können.
»Kommt weiter, sonst fahren uns die Busse weg!» schreie ich. Lässig und von oben herab schauen mich die beiden an:
»Wir fahren ja gar nicht mit. Wir gehen nicht stiften! Wir müssen ja den Krieg verlieren, wenn alles abhaut!«
»Mama, Mama, hast du gehört?«
»Ihr Lümmel«, krächzt die Mama mit deutlicher Anstrengung, ihr werdet wohl eure Pflicht darin sehen, eure Mütter und Geschwister heile nach Bayern zu bringen!«
»Ach sowas - das ist doch nichts Besonderes!« steht in ihren Gesichtern geschrieben. Wir schleppen uns weiter. Frau Hentz, die alles mitgekriegt hat, sagt provozierend unter ihrer Last keuchend:
»Dann blieven isch och he! Isch jon zurück!« Das sagt die Frau, die unsere Mutter so dringend gebeten hat, sie doch mit nach Bayern zu nehmen wegen ihrer Parteizugehörigkeit!
»Geht schon«, scheucht Hubert die Gesellschaft voran, »lasst uns erst mal an unserem Sammelplatz im Bunker sein!«
Diese Jungen mit ihrer Sehnsucht nach einer Heldentat! Noch weiß keiner von uns, und später wird es auch wohl keiner mehr zugeben wollen, dass unsere Mama jetzt schon und während der kommenden Schreckensreise ins gelobte Bayernland eine einzige nicht enden wollende Heldentat vollbringt. Mir fehlen die richtigen Worte. Aber die große, kräftig gebaute Frau Hentz benimmt sich störrischer als ein kleines Kind und der breit und groß gewachsene Hans auch. Die Mama trägt schwerer an ihrer Verantwortung für uns als Frau Hentz an ihrem sichtbaren Sack.
Aber zunächst einmal sind wir am Stadttor links abgebogen und an der Sammelstelle für Mütter und Kinder aus Münstereifel und Umgebung angelangt. Die Stadt wirkt wie ausgestorben. Zivilisten dürfen eigentlich nicht mehr draußen sein, es sei denn, sie sind auf dem Weg zur Sammelstelle. Heute ist der letzte mögliche Tag. Von der Partei eingesetzte Busse sollen uns an diesem Morgen von Münstereifel nach Neuwied bringen, heißt es. Aber noch sind sie nicht eingetroffen. Von Neuwied aus wollen wir dann mit dem Zug weiter Richtung Frankfurt - Niederbayern fahren. Wir glauben fest daran, dass von Neuwied aus noch die Eisenbahn verkehrt. Hier sind alle Eisenbahnstrecken lahm gelegt und kaputtbombardiert.
So, jetzt sind wir im sicheren Stollen angekommen. Draußen vernimmt man wieder das Tack Tack von Maschinengewehren. Wo steht die Front? Wenn ich doch nicht so erbärmlich frieren würde! Ich spindeldürres dreizehnjähriges Schlottergestell mit den Sommersprossen ohne äußere Zeichen kommender Fraulichkeit und den rötlichen Haaren sehe wohl mitleiderregend aus. Hier in den tief in den Berg geschlagenen Stollengängen verbreiten einige bullernde Mantelöfen etwas Wärme. Die klammen Finger und die verfrorenen Seelen werden ein wenig aufgetaut. Wir Mütter und Kinder, die flüchten wollen, warten auf den Autobus, der von der Partei eingesetzt werden soll, aber nur für Frauen und Kinder. Auch Männer, die hohe Posten in der Partei bekleiden, sind mit dabei. Frau Hentz kennt die meisten der Männer. Ein Bürgermeister ist mit von der Partie. Tische und Bänke sind in den Gängen aufgestellt, und aus den Regalen an den feuchten Felswänden nimmt der Bunkerwart Schwarzblechkonserven, die er an die Menschen hier verteilt. Es wird Mittag. Wir essen das kalte Gemüse aus den Dosen und warten immer noch im Bunker auf die Ankunft der Busse.
Hans und Hubert treiben sich dauernd draußen vor dem Bunker herum. Mama kann sich ihr bisschen heisere Kehle aus dem Hals schreien. Das macht den beiden nichts aus. Sie wollenes so hinkriegen, dass die Busse ohne sie abfahren, damit sie “kämpfen” können. Die zwei sind schrecklich! Wir sitzen hier und zittern und sorgen uns zusätzlich um sie.
Eine Frau aus Münstereifel mit ihren zwei Töchtern will sich uns anbiedern. Die eine Tochter ist jünger als ich und hat einen struwweligen Bubikopf, der am Morgen, als sie herkamen, noch lockig war. Ihre Schwester ist bestimmt schon 17 Jahre alt und sieht nett aus. Aber ihr Blick gefällt mir nicht. Sie hat schwarzes, füllig fallendes Haar. Frau Hentz kennt die Familie flüchtig. Eine Schwester der Mutter wohnt in Iversheim.
»Die Lü genießen keinen guten Ruf« sagt sie so, als sei das wichtig. Aber für mich ist das ein Satz voller dunkler Geheimnisse mit vielen Fragezeichen. Mama und ich distanzieren uns von den “fremden Leuten”. Frau Hentz unterhält sich mit der Frau über alles Mögliche. Im Verlauf des Tages ebbt der Fanatismus und die Lust zu kämpfen bei den beiden Jungen ab. Sie lungern mit uns auf den Bänken im Stollen herum und warten darauf, dass es endlich weitergeht. Und warum ändert sich ihr Verhalten? Ich merke, dass der Hentzer Hans Feuer und Flamme ist für die schwarze Schöne, die in keinem guten Ruf steht, wie Frau Hentz sagt, und auch schon mehrere Soldaten zum Freund gehabt haben soll. Und die Tatsache, dass das hübsche Mädchen dem Hans gefällt, ist der Hauptgrund, dass er nun bereit ist mitzuflüchten zu unseren Verwandten nach Niederbayern. Die Mutter der beiden Mädchen lässt durchblicken, dass sie auch Richtung Bayern wollen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Natürlich bleibt nun der Hubert nicht alleine hier, um Held zu spielen. Er reckt sich auch seinen Hals fast aus nach der Schönen. Aber er ist schüchtern und wird immer rot, wenn ihn das Mädchen mit den Augen anblitzt. Mein Bruder, der immer Milchbart zu mir sagt.
Meine kleine Schwester, die im Einheitskinderwagen liegt, wird im nächsten Monat schon ein Jahr alt. Sie ist während des ganzen Tages munter und fidel. Es ist ja auch allerhand los um sie herum. Sie langweilt sich kein bisschen, ist aufgedreht und juchzst. Aber jetzt soll sie schlafen. Sie liegt im Wagen. Und der Babykopf, der schon viel zu groß ist für diesen kleinen engen Kinderwagen, schiebt sich immer wieder halb hoch aus den Kissen, zitternd vor Anstrengung. Es ist nicht mit anzusehen. Hubert hat Mitleid mit dem kleinen Wesen. Er will es hochheben.
»Das ist Quälerei«, behauptet er und will das Geschöpfchen aus den warmen Kissen ziehen.
»Loß dat Künk ligge!« Frau Hentz Organ ist kräftig, ihre Gesten sind kräftig, die Frau ist kräftig.
»Legst du dich wohl hin!« schreit sie erbost tuend, sich in die Sichtweite des hochgehobenen Kinderköpfchens stellend. Und zack bum, haste nicht gesehen, plumpst das Köpfchen ins Kissen zurück. Das Kind schreit nicht, hat auch keine Angst, bleibt liegen, solange Frau Hentz im Blickfeld ist. Wenn Mama dasteht, Hubert oder ich, zeigt das kleine Wesen keinen Respekt. Aber Mamas Stimme ist nun vollends untergegangen in diesen schlimmen Katarr. Die paar Krächzer, die sie noch auf Lager hat, muss sie sich gut aufbewahren, es gibt noch allerhand zu tun. Irgendwann ist dat Künk eingeschlafen. Draußen ist es dunkel und stiller geworden. Drinnen im Stollen baumeln kahle Glühbirnen von der Decke herunter, die spärliches Licht verbreiten. Den ganzen Tag wird nur gewartet, gewartet und noch gewartet. Verlorene Zeit. Die Front rückt immer näher. Es ist zum Verzweifeln.
Wir sind aufgeregt, sitzen und wippeln auf harten Holzbänken ohne Lehnen. Die Männer von der Partei, zwischen denen die große Frau Hentz immer kleiner wird, klären uns auf:
»Ja, liebe Leute, so planmäßig geht das alles nicht mehr. Aber Geduld …«
Die Einsatzbusse, die schon für morgens 8 Uhr morgens avisiert waren, treffen genau 12 Stunden später als angekündet ein. Inzwischen hat es immer wieder Gerüchte gegeben. Eins davon ist, dass die amerikanischen Panzer schon Münstereifel erreicht haben. Und die Jungen sind wieder mal unterwegs - da draußen in einer Welt voller Krieg. Unsere Marschverpflegung haben wir restlos aufgegessen unter dem üblichen Geschrei des kleinen Heinz:
»Mam, der Hännes, der Kuhbalg, frisst mir alles fot!« Die Streiterei zwischen den beiden Brüdern kennen wir zur Genüge. Aber tatsächlich, der große Hans klemmt sich von der Portion des kleinen Heinz einen Teil Essbares ab. Der Einsatzbus steht auf dem Sammelplatz vor dem Bunker. Die Jungen verkünden es aufgeregt. Wer stürmt und rennt rücksichtslos mit den Armen wedelnd an Frauen und Kindern vorbei und besetzt den Autobus in Windeseile? Es sind die kräftigen Männer von der Partei, in gut gebügelten Zivilanzügen. Männer, die ihre Frauen und Kinder längst in Sicherheit wähnen.
»Es kommt ein Bus hinterher«, werden wir beschieden. Wir sind wütend und enttäuscht, denn der Bus, der nur für Frauen Kinder eingesetzt worden ist, ist pickepacke voll mit den Männern. Und der Hans Hentz, dessen Eltern auch - kleine! - Parteigenossen sind, dessen Vater an irgendeiner Front schießen muss, zischt zwischen den Zähnen hervor:
»Bonzen!« Da sitzen sie dick und fett, haben uns die Plätze weggenommen, und wir müssen hier bleiben in einer ausweglosen Unsicherheit. Das Kind ist wach geworden und schreit steinerweichend. Der Bus setzt sich in Bewegung, und unser jammervolles Trüppchen verharrt frierend in der Dunkelheit vor der Eingangstür des Bunkers und starrt hinterher. Die vagen Konturen unserer vermeintlichen Arche Noah verschwinden, lösen sich auf in Nichts, und wir flennen aus lauter Verzweiflung. Die Stadt ohne Leben und Lichter ist ein Scherenschnitt. Nur der Himmel lebt und dröhnt. Ich zitiere Mama:
»Die Ratten verlassen das sinkende Schiff!«
»Kommt rein, drinnen ist es wärmer«, sagt das schwarzhaarige Mädchen und tippt dem Hans auf die Schulter. »Die haben doch gesagt, es kommt noch ein Bus.« Wir zerren unser Gepäck wieder in den Stollen und warten hungrig weiter. Mehr können wir nicht tun. Zurück nach Iversheim dürfen wir nicht. Die Straße steht unter pausenlosem Beschuss. Eine halbe Stunde später trifft wahrhaftig ein weiterer Bus ein, auf den wir uns aus dem in den Berg gehauenen Stollen, sprich Bunker, durch das Tack Tack von Maschinengewehren in der Dunkelheit mit Schwung, Geschrei, Gezeter und Sack und Pack stürzen. Der Kinderwagen und unser Gepäck werden mit viel Getöse auf das Autobusdach befördert. Wir sind bei Gott nicht die einzigen, die mitfahren wollen. Dieser Bus ist schon wieder besetzt mit Männern in Zivilkleidung hier eingetroffen. Wir schaffen es dennoch, einen Sitzplatz zu ergattern. Wie nah ist die Front inzwischen gerückt? Jetzt sitzen wir endlich über den rollenden Autobusrädern und werden, so hoffen wir, fortgetragen aus der Nähe des wütenden Ungeheuers, der Front, in ein anderes Leben. Wirklich? Einen ganzen langen Tag haben wir im feuchten Stollen warten müssen. Im Bus ist es dunkel und beklemmend. Mama und ich verspüren die gleiche Angst, dass die Jungen vor den Parteigenossen etwas Unvorsichtiges sagen könnten. Sie fühlen sich so stark mit ihrer gefüllten Pistolentasche, und für sie sind diese feigen Männer Deserteure. Die Partei in der Heimat hat Angst vor den eigenen Deutschen und vor dem Feind! Aber der Hans hat Ablenkung. Er wird betuttelt von dem schwarzhaarigen Mädchen. Das Rollen der Räder, das Bewusstsein, dass wir uns endlich von der Front entfernen, beruhigt unsere Gemüter.
»Jetzt wird alles gut gehen«, unternimmt Mama einen Versuch, Zuversicht zu vermitteln. Das Baby Brigitte lacht auf Mamas Schoß und betatscht alle erreichbaren Gesichter. Frau Hentz sitzt mit dem kleinen Heinz hinten im Bus auf der letzten Bank zwischen Gepäck und Männer gequetscht und schwätzt mit ihnen. Na, die wird noch ihr blaues Wunder erleben! Und kaum, dass wir innerlich ein wenig zur Ruhe gekommen sind und uns notdürftig zurechtgesetzt haben, hingekauert zwischen Gepäck und Parteigenossen, hält der Bus schon an, und wir müssen raus, jawohl hinaus in die Dunkelheit. Wir krabbeln raus, ohnmächtig vor Enttäuschung, aber die Männer von der Partei wissen zu befehlen. Wäre doch unser Soldatenvater bei uns. Er würde uns beschützen vor diesen Feinden im glatten Anzug. Angeblich fährt der Bus wieder zurück - warum?
- um uns am nächsten Morgen wieder abzuholen, was uns hoch und heilig versprochen wird. Aber die Herren in Zivil, die der Frau Hentz als örtliche Parteigrößen alle bekannt sind, sind auch ausgestiegen. Das ist für uns so was wie eine Garantie, dass wir wieder abgeholt werden. Sie tragen keine Uniformen. Sie stehlen sich einfach davon. Unsere Väter sind Soldaten.
20 Kilometer haben wir uns von Münstereifel entfernt. Frau Hentz erkennt das große Gebäude, vor dem der Bus in der Dunkelheit Halt gemacht hat. In Friedenszeiten soll es ein beliebtes Ausflugsziel gewesen sein - das “Haus Hardt”. Bis vor einigen Tagen waren hier unsere Soldaten stationiert. Sie sind inzwischen abgerückt.
»Wären wir schon mal auf der rechten Rheinseite«, schimpft Hubert, »dann fühlte ich mich wohler!« Tja, dann würden wir uns alle besser fühlen. Kalter Nieselregen trägt nicht zu unserem Wohlbefinden bei. Ich mache ein hohles Kreuz in der Kälte unter meinem fadenscheinigen Mäntelchen, meine Nase tut weh, meine Trainingshose schlackert, meine Füße sitzen in zu engen abgelaufenen Schuhen, deren Sohlen Löcher aufweisen, und Mama krümmt sich in einer Hustenschauer. Das grelle Aufleuchten der Westfront begleitet uns als ständiges Wetterleuchten. Das schwarzhaarige Mädchen und der Hans stehen zusammen, deren Mutter mit der jüngeren Schwester bei uns. Frau Hentz schimpft und meckert. Die Männer von der Partei sind
- haste nicht gesehen - im Haus verschwunden.
»Isch jon zurück zo Foß, isch bliewen net he!« Als wenn das noch möglich wäre! Mama krächzt müde und heiser dazwischen. Das Kind trag’ich auf dem Arm. Es ist wach und zappelig. Die kleine Stupsnase ragt warm aus dem Packen. Ich lege das Kind in den Kinderwagen, der natürlich mit unserem Gepäck vom Bus runtergeholt worden ist. Unsere “Arche” verschwindet im blätterlosen kalten Wald. Hätten wir doch alles vorher gewusst!
»Los, lasst uns reingehen!« kommandiert Hubert. Wir setzen uns in Bewegung und gehen aufs Haus zu. Der kleine Heinz scheppert mit seinem leeren Aluminumkochgeschirr. Ist der nervig! Mir erscheint plötzlich unsere Lage unwirklich, so, als ob ich träume. Aber der Kanonendonner ist kein Traum. Es gibt kein Erwachen in einen normalen Tag hinein. Frau Hentz stapft voran schimpfend ins Haus, erst eine Treppe hoch, dann um die Ecke rum, eine Tür steht auf, und wir befinden uns in einem spärlich beleuchteten großen Saal, in dem sogar ein Kanonenofen bullert. Dann stellt sich heraus, dass die Fremdenzimmer in diesem Haus bereits alle belegt sind von den Männern aus der Partei, die sich vor uns den Weg ins Haus gebahnt haben. Eine Frau taucht auf, der man anmerkt, dass sie den Parteigenossen gern die Zimmer gegeben hat und uns Müttern und Kindern den harten Fußboden überlassen lassen muss. Sie trägt stolz ihr Parteiabzeichen an ihrem Kleid. Wir stapeln das Gepäck auf, und Mama und Frau Hentz wollen in dieser einsamen dunklen gefährlichen Gegend den nächsten Ort aufsuchen. Sie kehren nach einer Weile zurück und haben für sich, den kleinen Heinz und den Kinderwagen mit Inhalt im Ort für die Nacht eine Bleibe gefunden - mit Bett. Wir übrigen müssen hier kampieren. Wäre Frau Hentz nicht mitgekommen, hätte ich wohl mitgehen können. - Gute Nacht. - Sie gehen, und mir tut mein Herz weh. Und was sollen wir essen? Essen? Wir haben noch etwas Brot und schlucken es trocken runter. Vielleicht gibt es im Ort einen Laden, der morgen früh geöffnet hat, und wir können auf unseren Lebensmittelmarken etwas zu essen einkaufen. Es könnte sein. Vielleicht gibt’s noch Wunder!
Wir sitzen auf harten Holzstühlen herum und reden ein bisschen miteinander. Der Hans schäkert mit dem Mädchen unter den strafenden Augen von deren Mutter. Irgendwann legen wir uns auf den harten Holzfußboden, um eine schlaflose Nacht zu verbringen. Das schwarzhaarige Mädchen verschwindet mit dem Hans unter seinem Volkssturmmantel. Was ist denn schon dabei? Nichts! Die Mutter sagt ja auch nichts mehr! Sie dreht ihrer jüngeren Tochter die Haare auf Lockenwickler. Und morgen früh hat diese wieder Locken! Sowas aber auch! Sie erzählt uns wieder einmal, dass sie auch nach Bayern wollen. Aber nicht mit uns! Und morgen soll’s weitergehen mit dem Autobus auf die rechte Rheinseite nach Neuwied. Wär’s nur schon mal so weit!
Aber diese Nacht geht irgendwie vorüber. Auch wenn sie länger dauert als so manche andere. Zuerst liegen, dann sitzen und frieren wir auf dem harten Holzfußboden herum und warten darauf, dass die Nacht endlich vorüber ist. Wohin mögen sie fliegen, fragen wir uns, als wir die gewohnten Motorengeräusche der Bomberverbände hoch oben über uns wahrnehmen. Bitte, bitte nicht nach Bochum, denn dort ist unser Bruder Karlheinz als Flakhelfer in einer Flakstellung in Bochum-Weitmar eingesetzt. Und nebenbei findet noch Unterricht statt! Auch das monotone, dumpfe Rumoren der Front hindert uns mal wieder nicht daran zu spinnen, dass das Großdeutsche Tausendjährige Reich am Ende doch den Krieg gewinnen wird. Geheimwaffe - V 1 - V 2 - und so - Offensive - der Führer weiß, was er tut - der ist doch nicht blöd - der doch nicht! Aber wo steht das Ende des Krieges jetzt im Februar 1945 nach fünf Jahren Krieg? Irgendwo in der Zukunft. Nah? Fern? Wir sehnen den Frieden doch so heiß herbei! Ruhig schlafen können, keine Angst mehr haben vor dem Tod. Wann mag es das mal wieder geben?
Der nächste Tag ist nur ein einziges trostloses Warten. Die Stunden zerrinnen. Es wird Mittag. Es wird Nachmittag. Die Front rückt stündlich näher. Der Autobus, wo bleibt er? Ein Mann in einer Lederjacke, der in Haus Hardt ein Mansardenzimmer bewohnt, spendiert für unser Baby Brigitte eine Dose Büchsenmilch. So sieht also eine Dose Büchsenmilch aus? Glücksklee! Und Brigitte nuckelt ein leckeres Fläschchen leer.
»Mama, kommen wir hier noch mal weg?«
;»Ja sicher, Kind.« Frau Hentz schikaniert unsere Mutter ganz schön.
»Isch nemme minge Künner und jon hem!« frech und laut. Wie will sie das anstellen?
»Lass sie doch gehen, Mama!« Ich weiß ja, dass Frau Hentz nicht wirklich vorhat zu gehen. Das muss ihr ja der Verstand sagen. Wer kann denn was dazu, dass der Bus so lange ausbleibt? Was wird aus uns? Aber auch die wohlgenährten Herren in den glatten Anzügen warten. Da wird schon was passieren! Wir können ja nicht zu Fuß über den Rhein marschieren, der noch so weit weg ist!
Wir Kinder durchstöbern den Schuppen und den Hof. Da stehen Kisten und Kästen voller Kleiderstoffe, gefüllt mit Spielsachen und Lebensmitteln herum, dass ich nicht umhin kann, für Brigitte zwei Dosen Kindermehl zu klauen. Wenn das der Führer wüsste! Meine Güte, wer hat das hier alles gehamstert? Vielleicht kommt die Front gar nicht mehr bis hierher? Wer kann das schon wissen?
Der Abend bricht herein. Und in der beginnenden Dunkelheit gewinnt die massive Angst wieder Oberhand. Und dann beginnt die große Schau. Anders kann ich das Spiel nicht bezeichnen. Aber damals? War es ein Spiel? Ja, eins um Leben und Tod - so empfanden wir’s.
Das nasskalte Wetter ist richtig dazu angetan, uns den Tod mit all seinen Schikanen vorzustellen.
»Mama, Mama, der Bus kommt!« Wir stehen alle draußen, weil wir keine Ruhe mehr hatten und starren auf den in der Dunkelheit verschwindenden Wald. Aus dieser Dunkelheit heraus schält sich ein Bus mit abgeblendeten Scheinwerfern. Ganz schmale Streifen Licht sind das, die mühsam die Straße abtasten. Er hält an und steht breit und groß vor uns. Gott sei Dank! Das schlafende Kind wird aus seinem warmen Kinderwagen genommen, wird wach und nuckelt wild drauf los. Unser Gepäck ist im Nu draußen. Tja, da stehen wir nun vor einem schon wieder besetzten Autobus. Aber - hast du nicht gesehen - die Männer in Zivil stürzen sich auf die letzten freien Plätze, die von ihresgleichen freigehalten werden. Sie sind drin.
»Nein, Sie können nicht mehr mit! Sehen Sie nicht, dass der Bus überfüllt ist?« Ja sicher sehen wir das. Aber was heißt das? Wozu sind wir hier? Die Angst würgt mich mal wieder. Wie es scheint, passt kein Mensch mehr in den Bus.
»Mama, Mama, was machen wir?« Aber die beiden Jungen lassen sich nicht beirren und entdecken etwas von ihrem Heldentum in sich. Sie stören sich nicht an dem laufenden Motor. Sie bugsieren die Gepäckstücke und den Kinderwagen auf das Dach des Busses. Wir wissen, dass dieser Wagen nur für Frauen Kinder eingesetzt worden ist. Aber was hilft uns dieses Wissen? Mama krächzt diese Tatsache, kaum verständlich, in den Omnibus hinein. Und die Männer, diese starken Männer wollen uns hier am dunklen Straßenrand stehen lassen im Schussfeld der Front. Sie fürchten um ihre Haut aus anderen Gründen als wir. Sie wollen dem Feind nicht in die Hände fallen und glauben, auf der anderen Rheinseite sind sie in Sicherheit. Im Augenblick nutzen sie an uns ihre Macht aus. Ich finde keine Worte für mein Gefühl der Ausweglosigkeit.
»Holen Sie ihr verdammtes Gepäck wieder vom Wagen, sonst sind Sie das auch noch los!« schreit eine schneidende Männerstimme aus dem Innern des Busses.
»Das ist der Ortsgruppenleiter«, sagt Frau Hentz leise, hilflos und mit einem Ton Ehrfurcht in der Stimme. Die Männer schreien alle durcheinander. Ich muss an unseren Papa denken, der nie im Leben Frauen und Kinder dem Beschuss am Wegesrand ausgesetzt hätte, nur um seine eigene Haut zu retten. Ach, Papa, wärst du doch hier! Die Männer kennen kein Erbarmen. Aber es darf nicht sein, dass wir hier stehen bleiben. Frau Hentz, die große Frau Hentz ist klein geworden bei dieser Vielzahl von Parteibonzen, d.h. sie akzeptiert und bewundert deren Posten in der NSDAP.
»Hännes, holl dat Gepäck ad wedder heraf!« wendet sie sich an ihren großen Sohn Hans. Der Mama zischt sie zu:
»Wir jon kapott!« Und Mama, die fast keine Stimme mehr hat, krächzt wie ein todwunder Rabe:
»Los Jungs, zeigt, was ihr könnt!« Der kleine Heinz heult jämmerlich. Baby Brigitte quietscht vor Vergnügen. Ich kreische erschrocken los:
»Die fahren ja wirklich!« Tatsächlich hat sich der Autobus in Bewegung gesetzt. Unser Gepäck liegt obenauf und wir laufen wilde Schreie ausstoßend hinterher.
»Ich schieß den Bonzen die Reifen platt!« Der Hans zieht seine Pistole aus der Ledertasche und fuchtelt bedrohlich in der Luft herum. Und der Autobus hält an, ohne dass Hans losfeuert. Wir dürfen jetzt halb ohnmächtig geworden in den überfüllten Bus klettern. Vage erkennen wir böse harte Männergesichter zwischen ihren Kisten, Koffern und sonstigem Gepäck. So viele Männer sitzen gar nicht in dem Bus. Dieser ist vollgepfropft mit Gepäck statt mit Müttern und Kindern. Ruck zuck, setzen sich die Mutter aus Münstereifel und ihre beiden Töchter, die sich während der letzten Minuten völlig ruhig verhalten haben, auf die paar freien Plätze. Hans und Hubert werden nach draußen gescheucht. Der übermüdete Hubert setzt sich auf den rechten Kotflügel des Busses, und der Hans steigt auf den Gepäckständer auf dem Dach des Autobusses.
»Lieber Gott, mach, dass die beiden nicht herunterfallen!« Mama kann sich auch irgendwo mit dem Baby hinsetzen. Ein großer Mann ist aufgestanden für die beiden. Frau Hentz sitzt im Gang auf einer Kiste. Und ich muss hinten auf einen Berg von Gepäck klettern, der auf der langen Bank bis unter die Decke gestapelt ist. Ich sitz obenauf zusammengeklappt wie ein Taschenmesser. Die Männer sprechen kein Wort mit uns. Aber Gott sei Dank setzt sich unsere vermeintliche “Arche Noah” wieder in Bewegung. Hurra, wir fahren! Die rechte Rheinseite lockt uns wie ein Paradies an, das zu erreichen wir nicht mehr gehofft haben. Schon nach fünf Minuten glaube ich es in dieser gebückten Haltung nicht mehr aushalten zu können. Mein Nacken! Mein Kopf! Meine Beine! Aber ich recke mein Kinn hoch und beobachte so gut es geht die vor mir unten sich bewegende Mannschaft. Leises Gemurmel. Die ältere Tochter - Hans Schwarm
- schäkert mit dem Mann, der neben ihr sitzt. Frau Hentz schläft auf der Holzkiste, und der kleine Heinz steht eingezwängt zwischen Koffern und Kästen und wackelt hin und her. Warum nimmt Frau Hentz ihn nicht auf den Schoß? Mama sitzt völlig eingequetscht zwischen dem fremden Gepäck mit dem Baby im Arm. Ich kann nicht mehr. Ich werde lahm hier oben. Was machen die Jungen draußen in dem eisigen Fahrtwind? Wenn die runterfallen! Der Bus zuckelt durch den bellenden Abend. Der Automotor übertönt das Brummen der Flugzeuge am lebhaften Himmel! Aber die Jungen! Meine Beine sind eingeschlafen. Mein Nacken tut so weh, dass ich ihn fast gar nicht spüre. Und auf einmal muss ich lachen bei meiner Vorstellung: Da sind wir dem Tod noch mal von der Schippe gesprungen! Irgendwann döse ich vor mich hin. Im Halbtraum rufe ich: »Mama, ich komme!« Ich kann hier nicht runterspringen, so eng ist das. Da hebt mich der Mann, der der Mama seinen Sitzplatz gegeben hat, herunter. Ich knick auf dem Boden zusammen. Aber schnell erwachen meine steifen Glieder wieder, und ich bleibe neben Mama stehen. Hier drinnen kann keiner bemerken, wenn die Jungen draußen auf dem Kühler und dem Verdeck gegen ihre Müdigkeit kämpfen. Hubert wackelt hin und her, zuckt zum Glück immer wieder erschreckt zusammen, wenn es den Ruck gibt runterzufallen. Ein Glück, dass er uns später noch alles erzählen kann. Seine Mütze mit den Ohrenschützern ist ihm längst vom Kopf geflogen. Das Kind ist wach geworden und schreit. Ich nehme Brigitte auf meinen Arm. Nach kurzer Zeit patscht sie mir mit ihren Babyhändchen ins Gesicht. Sind wir eigentlich noch Menschen auf dieser unserer Erde? Ich weiß es nicht. Der Bus hält plötzlich mit einem harten Ruck an. Was ist los?
»Lass die Vorhänge zu!« schreien ein paar Männer, als ich mich weit herüberbeuge, um rauszugucken. Brigitte ist wieder bei Mama. Was gibt’s denn schon wieder? Die Männer stehen von ihren Plätzen auf und steigen aus. Und wir müssen uns nun auf diese Sitzplätze verteilen. Auch die Jungen werden hereingeholt. »Lieber Gott, danke, dass sie noch leben!«
Schau einer an, wie gut es uns geht! Aber durchschaue es einer sofort!
»Wir sind in Ahrweiler« sagt Mama. Und jetzt dürfen wir auch durch die trüben Fensterscheiben gucken. Es sieht von draußen sicherlich recht nett aus, als die Mütter und Kinder durch die Fensterchen auf eine abgedunkelte Tankstelle blicken.
»Diese Hunde«, ist alles, was die Jungen über ihre erbosten Lippen bringen.
»Soviel Schlechtigkeit gibt es doch gar nicht«, flüstert Mama heiser. Wieso? - Ha, ha, wir sitzen großzügig verteilt und wohlverwahrt, scheinbar viel Platz beanspruchend, auf den freigemachten Plätzen im Omnibus.
»Ist alles in Ordnung«, sagt der Mann von der Tankstelle, der hereinguckt, um festzustellen, ob der Bus auch tatsächlich mit Frauen und Kindern besetzt ist. Weil das so ist, so zu sein scheint, wird der Bus betankt. Raffiniert haben die Herren von der Partei dieses Problem gelöst! Ein Soldat von der Feldgendarmerie schaut in unsere bequem sitzende Runde und sagt freundlich zu uns:
»Gute Weiterfahrt!« Kaum hat er seinen Satz zu Ende gesprochen, heulen schauerlich wohl in ganz Ahrweiler auf einmal die Sirenen los, anders als sonst bei Fliegeralarm.
»Mein Gott, Luftlandealarm!« Schreie von draußen. Nein, nein, lieber Gott, bitte, bitte nicht! Im Geiste sehe ich Fallschirme vom Himmel rieseln wie Pusteblumen im Sommerwind.
Weiter - weiter! Gelenkig und elegant springen die Herren Parteigenossen, die sich draußen die Beine vertreten haben, - warum hat man sie nicht einfach dabehalten? - in den Bus zurück, und hopp, hopp, werden wir von den Sitzplätzen verjagt, und die machen es sich wieder bequem. Die Jungen sitzen auf ihren Beobachtungsposten, dem Kotflügel und dem Dachgepäckständer. Der Bus fährt an, und weiter geht’s ins Ungewisse.
Erinnerungen - aufgeschrieben ca. 1950