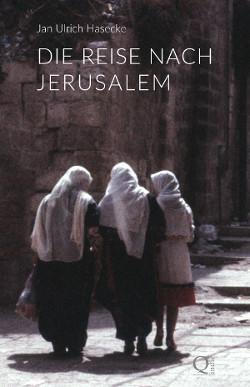Der November 1944 war besonders kalt und nass.
Seit fast zwei Monaten hausten wir nun hier in einer Bretterbude am Waldrand, nachdem wir vor der heranrückenden Front geflüchtet waren. Es war nicht allzu weit entfernt von unserem Heimatdorf. Mein Vater war davon ausgegangen, dass wir wieder heimkehren könnten, sobald die Alliierten unser Dorf eingenommen hätten.
»Heute Nachmittag«, so erzählte Vater eines Abends, als wir wieder einmal frierend am prasselnden Feuer vor unserer Behausung saßen, »habe ich deutsche Soldaten getroffen, die mir sagten, dass die Kameraden in den Westwallbunkern den Vormarsch der Amerikaner gestoppt hätten.« Und nach einer Weile fügte er hinzu: »Ich fürchte, bei dieser Kälte können wir es nicht mehr lange hier aushalten.«
»Juchhu! Dann können wir ja nach Hause!« rief ich spontan, »ich möchte so gerne in ein warmes Bett!« »Ich auch und ich auch«, unterbrachen mich lautstark meine Schwester und mein Bruder. Vater erklärte uns, dass es gar nicht abzusehen sei, wann wir zurückkönnten. »Aber darauf können wir nicht warten«, sagte Mutter ganz energisch. »Wir müssen morgen früh unsere Sachen packen und darauf hoffen, dass gute Leute uns irgendwo in einem Dorf aufnehmen.« Und mit einem sorgenvollen Blick auf unseren Jüngsten, der im Kinderwagen wieder einen Hustenanfall bekam, murmelte sie: »Hier werden wir noch alle sterbenskrank.«
Am nächsten Morgen halfen alle mit, die wenigen Habseligkeiten auf den Wagen zu verstauen, während Vater das Pferd anschirrte. Mittags erreichten wir das erste Dorf. Aber in keinem Haus war Platz für uns. Viele Flüchtlinge aus anderen Dörfern waren hier schon untergekommen. Also, mussten wir weiterfahren und ich bemerkte die große Enttäuschung bei meinen Eltern.
Kurz bevor es Dunkel wurde, fanden wir schließlich im nächsten Ort ein älteres Ehepaar, das bereit war, uns zwei Zimmer zu überlassen. »Vor drei Wochen haben wir erfahren, dass unsere beiden Söhne gefallen sind«, hörte ich die alte Frau zu meiner Mutter sagen. »Deshalb könnt ihr jetzt die Zimmer haben«, schluchzte sie.
Wir waren überglücklich, wieder in einem Haus - wenn auch auf engstem Raum - leben zu können. Gerne half Mutter den alten Leuten im Haushalt und im Stall die zwei Kühe zu versorgen. Mein Vater konnte auf einem Bauernhof in der Nähe arbeiten. Als Lohn erhielt er Milch, Butter und selbst gebackenes Schwarzbrot.
Eines Tages erklärte meine Mutter mir, dass ich ab morgen im Nachbardorf in die Schule gehen müsse. Davon war ich gar nicht begeistert. Ich fand das Leben ohne Schule viel schöner. Am nächsten Morgen packte Mutter mir ein Butterbrot und eine kleine Flasche mit Milch in eine alte Stofftasche. Meine Schultasche, die Bücher und die Hefte hatten wir natürlich vergessen, als wir geflüchtet waren. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch trottete ich dann zur Schule und setzte mich auf einen freien Platz in die letzte Bank. Der Lehrer hieß Berners, war groß, hatte einen riesengroßen Schnauzbart und sprach in einem Ton, als ob alle Schüler Soldaten wären. Das erste was er mir zeigte, war ein zwei Meter langer Haselnussstock, den er »Heinrich« nannte. »Der ist nur für die Jungens da, denn die Mädchen sind brav und folgsam«, klärte er mich auf. Wenn einer schwätzte, oder seine Hausaufgaben nicht vollständig gemacht hatte, nahm er den Stock und rief empört: »Heinrich, walte deines Amtes!« Ich habe anfangs meistens mitgeheult, wenn ich sah, wie wollüstig er mit dem Stock solange auf einen Jungen eindrosch, bis dieser erbärmlich jammerte. In meiner Heimatschule hatten wir natürlich auch manchmal Prügel bekommen, wenn wir nicht aufpassten oder störten. Aber die waren gut auszuhalten. So entwickelte sich bei mir vom ersten Tag an eine unbeschreibliche Wut gegenüber dem Lehrer. Ich überlegte immer wieder krampfhaft, was ich tun könnte, um den Stock verschwinden zu lassen.
Eines Tages, als die Sirenen einen Luftangriff ankündigten und wir in den Keller mussten, wartete ich, bis alle aus dem Klassenzimmer waren, und schnappte mir dann den verhassten Stock, brach ihn in zwei Teile und warf ihn aus dem Fenster. Am nächsten Tag wartete ich aufgeregt darauf, was passieren würde. Doch zu meiner Überraschung suchte der Lehrer nicht nach seinem »Heinrich«, sondern schickte uns nach Hause mit den Worten: »Die Front kommt immer näher und die Partei hat verfügt, dass bis auf weiteres kein Schulunterricht mehr ist.« Tatsächlich hörten wir in den nächsten Tagen massiven Geschützdonner. Einzelne Granaten schlugen am Rande des Dorfes ein.
Nachts mussten wir alle in den Keller, aber schlafen konnte niemand. »Ich habe die Kellertür aufgelassen«, hörte ich meinen Vater eines Abends ziemlich aufgeregt zu den beiden alten Leuten sagen, denen das Haus gehörte. »Wahrscheinlich kommen diese Nacht die Amerikaner«, fügte er leise hinzu, »und da ist es besser, wenn die Tür nicht zu ist.« Ich muss wohl eingeschlummert sein, denn als ich plötzlich aufschreckte, hörte ich fremd klingende Männerstimmen. Das sind bestimmt die Amerikaner, schoss es mir durch den Kopf.
»Wo Soldat, wo Nazi!« schrien zwei schwer bewaffnete Soldaten im gebrochenen Deutsch und richteten ihre Gewehre auf meinen Vater und den alten Mann. Ich klammerte mich, genauso wie meine Geschwister an meine Mutter und dachte, dass sie uns jetzt alle erschießen würden. Aber die Amerikaner verlangten nur, dass sich alle mit erhobenen Händen an die Wand stellten. Dann rissen sie alle Schränke auf und durchwühlten das Bettzeug. Einer schoss mit seinem Maschinengewehr die Nebentür, die zum Vorratskeller führte und verschlossen war, einfach auf. Der andere Soldat stieß mit dem Gewehr das Tuch, dass meine Mutter über den Kinderwagen, in dem mein kleines Brüderchen lag, gehängt hatte, herunter. Er zuckte erstaunt zusammen, als er das Baby sah. Langsam drehte er sich zu meiner Mutter um, die wie Espenlaub zitterte, klopfte ihr auf die Schulter und sagte: »Ich auch haben Baby.« Dann kramte er in seiner Hosentasche, zog eine Büchse hervor und gab sie meiner Mutter. Als die beiden amerikanischen Soldaten später abgezogen waren, öffnete Mutter vorsichtig die Büchse und sagte erstaunt: »Da ist ja Milchpulver drin.«
Irgendwann im Februar 1945 erfuhr mein Vater, dass die Amerikaner vom nächsten Dorf aus, Flüchtlinge mit Militärfahrzeugen in die Dörfer zurückfuhren, die schon erobert waren. So konnten sie in den Orten, die nahe an der Kampflinie lagen, ihre eigenen Soldaten unterbringen. Am nächsten Tag machten wir uns im Schneegestöber und bei klirrender Kälte mit dem Handgepäck und dem Kinderwagen zu Fuß auf den Weg. Fast zehn Kilometer waren es bis ins nächste Dorf. Durch knöcheltiefen Schneematsch wateten wir stundenlang über die einzige noch befahrbare Straße. Hier rollte pausenlos der Nachschub der amerikanischen Armee. Wir mussten immer wieder in den Straßengraben flüchten, um nicht von den Panzern und LKW überfahren zu werden. So brauchten wir unendlich lange, ehe wir am späten Nachmittag den Sammelplatz im Nachbarort erreichten. Der letzte Transport mit Flüchtlingen, die an diesem Tag in unseren Heimatort gefahren wurden, war natürlich fort, als wir ankamen.
In der nahen Dorfkirche, die nur geringfügig beschädigt war, wurden wir für die Nacht untergebracht. Meine Mutter fand unter einer Muttergottesfigur einen kleinen Kerzenstumpen, den sie sofort anzündete. Dann bereitete sie aus dem restlichen Milchpulver und dem Wasser aus dem Weihwasserkessel, die letzte Tasse Milch. Mit Hilfe des Kerzenlichtes versuchte sie die Milch warm zu machen, damit mein kleines Brüderchen von gut einem halben Jahr etwas Warmes zu trinken bekam. Aber Max war von den Strapazen der letzten Tage und Wochen so geschwächt, dass er nicht mehr trinken wollte. Es war eiskalt in der Kirche. Mit den durchnässten Sachen am Leib mussten wir auf den harten Holzbänken die Nacht verbringen. Es waren etliche Familien hier und die ganze Nacht hindurch schrie und jammerte irgendwo ein Kind vor Kälte und Hunger. Irgendwann in dieser Nacht hörte ich meine Mutter laut seufzen und zu meinem Vater sagen: »Max ist tot.« Ich kroch zu meiner Mutter und heulte lange in ihren Armen, obwohl ich gar nicht so recht wusste, was tot eigentlich war.
Noch in der gleichen Nacht schaufelten mein Vater und ein Mann aus dem Dorf neben der Kirche ein Grab aus. Wir durften ja kein totes Kind am nächsten Morgen mit auf den amerikanischen LKW nehmen. Als wir dann schon in der Frühe auf das Militärfahrzeug steigen sollten, bekam meine Mutter einen Schwächeanfall. Ein amerikanischer Sanitäter, der zufällig in der Nähe war, gab ihr eine Spritze und danach hob mein Vater sie auf das Fahrzeug.
Am späten Nachmittag erreichten wir unser Heimatdorf. Während der Fahrt fuhren wir an vielen zerschossenen und eingestürzten Häusern vorbei. Ich überlegte, ob unser Haus auch wohl so aussehen würde. Doch schon von weitem konnten wir sehen, dass unser Haus noch stand. »Gott sei Dank!« rief meine Mutter freudig erregt. Als wir dann aber näher kamen, sahen wir, dass mehrere Granaten in das Dach eingeschlagen waren. Im Haus gab es keine Türen und keine Fenster mehr. Die Möbel lagen auf einem großen Haufen im Garten. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass meine Eltern bitterlich geweint haben. Meine Mutter war die erste, die sich wieder fing und zu Vater, der völlig deprimiert dastand, sagte: »Hans, wir schaffen das schon!«