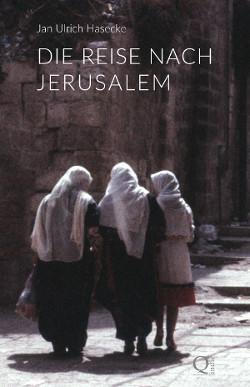In meinem zwölften Lebensjahr, kurz bevor die Welt aus den Angeln zu geraten schien, traf ich sie. Sie war nicht älter als ich und hatte große dunkle Augen und schwarzes glänzendes Haar. Ihre wunderschöne Haut war von der eisigen Januarkälte krebsrot gefärbt. Ich war fasziniert von der Ausstrahlung dieses Mädchens. Ihre Kleidung war nicht bemerkenswert. Sie trug einen langen schwarzen Mantel, der ihre Figur verhüllte, abgetragene Schuhe, einen verwaschenen Schal sowie mehrfach gestopfte Wollhandschuhe. Aber ihre Augen, diese dunklen Augen verzauberten mich, alles andere war nebensächlich.
Kurz vor dem kleinen Tante-Emma-Laden, der sich hochtrabend und dem Stil der damaligen Zeit angemessen Kolonialwarenhandlung nannte, begegneten wir uns. An der Hand ihrer Mutter, die ebenso ärmlich wie sie gekleidet war, stand sie urplötzlich vor mir. Fast gleichzeitig wollten wir zu dritt den kleinen Laden betreten. Hochrot vor Verlegenheit ließ ich ihnen den Vortritt. Und ich stellte mich dabei so ungeschickt an, dass es dabei zu einem kleinen, von lächelnden Gesichtern erhellten Gedränge kam.
Ich kam diesem Mädchen ganz nah, ich berührte sie, unfreiwillig zwar, aber mit einem unvorstellbaren Gefühl von Zuneigung. Was war das nur? Was ging in diesem Augenblick in mir vor? Ich wusste es nicht, ich wusste nur, dass ich völlig verwirrt und zu keinem klaren Gedanken fähig war. Es war solch ein unvorstellbares Gefühl, dass ich es heute noch spüre.
Mutter und Tochter stellten sich abseits in eine Ecke des Ladens Außer uns und der Inhaberin, wir nannten sie “Tante Irmgard”, war niemand im Laden. Ich wusste auch nicht, warum Tante Irmgard mich unbedingt zuerst bedienen wollte. Doch genau das wollte ich entgegen meiner sonstigen Art nicht. Ich wollte mit diesem Mädchen noch länger in einem Raum sein, wollte sie immer wieder ansehen.
Ihre unergründlichen Augen versetzten mich in eine Art Trance. Und so saß ich dann mitten zwischen Sauerkrautfass und Steckrübenkisten und bewegte mich nicht von der Stelle. Tante Irmgard blieb einfach nichts anderes übrig, als die beiden vor mir zu bedienen.
Obwohl ich nur Augen für das Mädchen hatte, nahm ich doch wahr, dass Tante Irmgard hinter dem Ladentisch ständig etwas verpackte und verschnürte. Im Zeitalter der Lebensmittelkarten war das immer etwas, auf das wir Kinder ein Auge haben sollten. So hatten es uns die Erwachsenen eingeprägt. Ich hatte also ein Auge darauf! Dort wurde ein Brot eingepackt, ein Würfel Margarine, Salzheringe und auch ein Stück Käse. Und vor allem: Es wurde nicht bezahlt. Seltsam fand ich das schon, aber meine Verliebtheit in dieses bezaubernde Mädchen, diesen engelhaften Traum, ließ mich alles vergessen.
Ich zitterte förmlich, wenn sie mich ansah, und sie sah mich sehr oft an, verstohlen zwar und von der Seite, aber ihr Interesse an mir schien so offensichtlich zu sein, dass sogar ihre Mama sie sanft zu sich herumdrehte und sie dabei leicht strafend anschaute.
So vergingen die Minuten und mir erschienen sie wie Stunden in einem Traum. Ein Traum, aus dem ich erst erwachte, als Tante Irmgard nach meinen Wünschen fragte. Ich hatte alles vergessen. Ich wusste nicht mehr, was ich für Mutter einholen sollte. Ich stotterte vor mich hin und Tante Irmgard lachte hell auf. Sie hatte solch ein glockenhelles Lachen, dass man es am liebsten gehabt hätte, wenn sie ständig nur gelacht hätte. Irgendwie bekam ich dann meine Einkäufe, die Gedanken, die Lebensmittelmarken und das eben Erlebte unter einen Hut. Es war ein Konglomerat von Gefühlen, das in meinem jungen Geist einfach nicht zu bändigen war. Aus allem jedoch ragte dieses Mädchen hervor.
Kaum vernehmbar waren ihre Worte, die sie mir beim Hinausgehen ganz leise zugeflüstert hatte. Ganz verschämt und wahrscheinlich nur für mich deutlich zu hören. Ich verstand sie damals nicht. Erst sehr viel später lernte ich ihre Bedeutung kennen. Doch vergessen habe ich sie nie: »Gitt schabbes!«
Es vergingen Tage und Wochen. Der Frühling hielt Einzug. Ich jedoch war immer noch im Winter. Schneeglöckchen statt Maiglöckchen. Ich hielt Ausschau auf dem Schulweg und in den Pausen auf dem Schulhof, doch ich fand dieses Mädchen nicht mehr. Unruhig streifte ich durch die Nachbarstrassen meines Stadtviertels. Ohne Ergebnis. Nirgendwo war auch nur eine Spur dieses Traums zu finden. Meine Mitschüler verspotteten mich als “Tagträumer”, doch es störte mich nicht im Geringsten.
Endlich fasste ich mir ein Herz und vertraute mich meiner Großmutter an. Sie sah mich lange und sehr verständnisvoll an, streichelte mir über das Haar, seufzte schließlich tief und sagte: »Warum gerade dieses Mädchen? Das ist Miriam, die Tochter unseres früheren Arztes, Dr. Rosenbaum. «
Miriam! Das klang wie Musik in meinen Ohren, eine fremde Melodie. Für mich war es, als würden im Garten Blumen singen und die Vögel dazu Reigen tanzen. Miriam.
Und dann sagte meine Oma noch etwas für mich Unverständliches: »Bitte, forsch da nicht weiter nach. Es ist sehr gefährlich. Für sie, für dich, für uns alle! Sie darf nicht mit euch spielen. Sie darf nicht in die Schule gehen!« Rätsel über Rätsel. Ich verstand nicht, was damit gemeint war. Warum ist es gefährlich, einen Menschen zu suchen, den man über alles in der Welt gern hat? Warum durfte sie nicht die Schule besuchen? Warum musste das so sein? Ich träumte weiter meinen Traum von einer Kinderfreundschaft, einer Kinderliebe! Und ich suchte trotz aller Warnungen weiter. Vergeblich. Ich fand sie nicht.
Irgendwann im Herbst des gleichen schönen, schmerzvollen Jahres aber ging mein Traum in Erfüllung! Unsere ganze Schule war zum Ernteeinsatz bei den Bauern der Umgebung angefordert, zum freiwilligen Ernteeinsatz. Wir taten es gern, befreite es uns doch von der lästigen Schule.
Früh am Morgen, gegen 5 Uhr, es war noch ziemlich dunkel, versammelten sich alle Schüler und Lehrer auf einem Platz in der Stadt. Wir warteten auf die Fahrzeuge, die uns aufs Land bringen sollten. Alle Mitschüler waren damals mit dem bei der Jugend obligatorischen braunen Hemd mit schwarzem Halstuch gekleidet. Aufgeregtes Geplapper, hier und dort ein Gerangel. Die Lehrer brachten kaum Ordnung in den wilden Haufen.
Und dann kamen die LKWs. Es waren zwei. Wir drängten uns an die Straße vor, jeder wollte natürlich der erste sein. Aber was war denn das? Wie sollte das gehen? Die Wagen waren besetzt. Mit Frauen, Kindern und alten Männern. Sie standen, mühsam Halt suchend, auf diesen Lastwagen. Ein wenig Gepäck, ärmliche Kleidung. Und auf dieser Kleidung trug jeder von ihnen einen gelben Stern mit der Aufschrift: Jude!
Das also waren die Juden, von denen wir so viel gehört hatten. Mit Abscheu wurde in der Schule von ihnen gesprochen. Das waren sie also! Wir alle johlten laut und schrien unflätige Worte zu ihnen hinauf. Und diese Menschen? Sie sagten nichts. Mit unsäglich traurigen Blicken sahen sie diese uniformierten jugendlichen Helden an. Und dann traf es mich wie ein Keulenschlag, der letzte Schrei blieb mir im Hals stecken.
Dort stand mein Traum! Mein Traum hatte mich gefunden. Miriam. Bei diesen Juden. Miriam, die ich ständig gesucht hatte. Dort oben auf dem Wagen, neben ihrer Mutter und etlichen anderen Menschen. Sie war es, und so sehe ich sie noch heute vor mir! Die kleine zaghafte Geste des Erkennens, ein verstohlenes winzigkleines Lächeln in ihrem schmalen Gesicht, in diesem Gesicht, das ich Monate lang vor mir gesehen hatte.
Der Lastwagen, der kurz stoppen musste, fuhr wieder an. Es war ein Meter, ein winzigkleiner, riesengroßer Meter, der mich von ihr trennte. Dann hörte ich ihre Stimme, wieder so leise, wie sie damals zu mir gesprochen hatte. Sie sagte. »Masseltov!«
Ich verstand nicht. Tonlos versuchte ich, diese Worte nachzusprechen, ein fast unsichtbares Nicken von ihr war die Antwort. Und ich? Ich wagte es tatsächlich, ihr kurz zuzuwinken, ich wagte es, inmitten dieser wilden grölenden braunen Horde ihr zuzuwinken! Dann war es vorbei. Ich sah ihre wunderschönen Augen nicht mehr. Die LKWs verschwanden hinter einer Kurve und mit ihnen die Menschen.
Später fragte ich meinen alten Lehrer nach den Juden auf den Wagen. Er schwieg zunächst. Dann sah er mich lange an, wollte eine erklärende Bemerkung machen und sagte dann aber nur vorsichtig: »Ach die, die werden alle umgesiedelt. In den Osten. Dort passen sie besser hin als hier ins Reich!« Umgesiedelt. Passen besser. Ich verstand das nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Und ich will es auch nicht verstehen.
Später aber habe ich Miriam verstanden, ohne Worte. Ich verstand ihre verstohlene Bewegung, ihren Blick, der mich mitten ins Herz traf.
Ich habe Miriam in meiner Erinnerung behalten, so wie sie war, so wie ich sie liebte, kindlich und rein, und ich denke auch heute noch an sie, ohne Pathos, aber mit dem Gefühl der Traurigkeit im Herzen.
»Masseltov!«
Sie hatte es nicht, dieses Glück. Die Rosenbaums wurden in das Ghetto nach Lodz gebracht. Ein Jahr später gab es das Ghetto nicht mehr. Aber es gab Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek.
Aber das wusste Miriam noch nicht. Ich wusste es damals auch nicht. Und viele, die es wussten, wussten es später auch nicht mehr.
Erklärung der jiddischen Worte:
- Gitt schabbes
- Guten Sabbath, entspricht etwa dem christlichen Gruß “Schönen Sonntag”
- masseltov
- massel ist ein Wort für “Glück”, tov bzw. tovte bedeutet “gut”. Sinngemäß bedeutet masseltov also “Viel Glück”