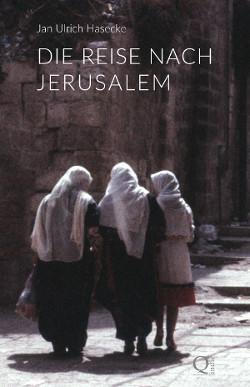Meine Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft im Dorf. Vater war vom Militärdienst freigestellt. Er musste dafür in den Kriegsjahren täglich mit Pferd und Wagen in mehreren Dörfern die Milch bei den Bauern abholen und zur Molkerei fahren. Meistens kam er erst am späten Nachmittag nach Hause, sodass meine Mutter viele Arbeiten im Stall und auf dem Feld alleine verrichten musste. Daneben hatte sie noch uns vier Kinder zu versorgen.
Als ihr dann im Herbst 1943 eine junge Russin als Hilfe zugeteilt wurde, war das für sie eine spürbare Erleichterung. Die Frau war fünfundzwanzig Jahre alt, sehr scheu und konnte etwas deutsch. Im Obergeschoss unseres Hauses hatte mein Vater ein Zimmer hergerichtet, in das ich nach den Ferien einziehen sollte.
Ich war schon sehr enttäuscht, dass dort nun die russische Frau untergebracht wurde, und ich mit meinen neun Jahren auf ein eigenes Zimmer verzichten musste. »Junge, du willst doch nicht, dass Anastasia auf dem Heustall schlafen soll, so wie die arme Anuschka, die beim Ortsbauernführer arbeiten muss«, sagte meine Mutter zu mir, als ich bei ihr motzte.
Anastasia lebte sich rasch ein, war meistens vergnügt und machte ihre Arbeit gut. Obwohl es offiziell verboten war, saß sie bei jeder Mahlzeit mit uns am Tisch. Nur wenn es an der Haustür klopfte, musste sie sofort in die Küche verschwinden.
In der riesigen Strohmiete, die nicht weit von unserem Haus stand, hatte ich mir einen geheimen Gang durch die Ballen gebaut. So konnte ich alles rund um die Miete genau beobachten. Eines Nachmittags hörte ich plötzlich in der Nähe flüsternde Stimmen. Durch meinen gut getarnten Ausguck konnte ich sehen, wie in einer Ecke des Strohschobers Anastasia mit einem mir fremden Mann tuschelte. Ab und zu küssten sie sich.
Am nächsten Tag, wir waren gerade alleine in der Küche, fragte ich Anastasia, ob sie einen Freund habe. Erst sah sie mich verblüfft an, doch dann wurde sie traurig. In ihrem gebrochenen Deutsch versuchte sie mir zu erklären, dass niemand wissen dürfe, dass sie sich mit ihrem russischen Freund heimlich treffen würde. »Wenn du sagen … du uns sehen … schießen Deutsche … uns tot!« seufzte sie. Ich konnte mir das zwar nicht vorstellen, doch ich spürte instinktiv, dass ich diese Beobachtung für mich behalten musste. Meinen Eltern habe ich auch nichts davon gesagt.
Schließlich kam der Heilige Abend, auf den wir Kinder so sehnsüchtig warteten. Das ›gute Zimmer‹ (es wurde nur an Sonn- und Feiertagen benutzt) war schon Stunden vorher für uns abgeschlossen. Mutter und Anastasia huschten zwischendurch rein und raus, um alles für die Bescherung vorzubereiten. Nachdem die ganze Familie gebadet hatte, ging ich mit meinen Eltern um zwanzig Uhr in die Christmette. Anastasia verwahrte inzwischen meine Geschwister.
Dann war es endlich soweit. Wir Kinder sahen den festlich geschmückten Weihnachtsbaum überhaupt nicht, sondern versuchten abzuschätzen, welche Geschenke wohl in den mit bunten Bändern verschnürten Paketen waren.
Doch bevor ausgepackt werden durfte, mussten sich alle um die Krippe stellen, um ein Weihnachtslied zu singen.
»Wo bleibt Anastasia?« fragte Vater meine Mutter.
»Ich hab alles versucht, aber sie will nicht runterkommen. Sie sagt, dass ist ein Abend nur für die Familie. Ich versteh sie nicht!« Mutter sah traurig aus.
Vater überlegte einen Moment. »Dann geh du doch nach oben«, sagte er zu mir, »vielleicht kannst du sie überreden.«
Ich rannte los und sah, als ich die Tür aufmachte, dass Anastasia vor dem Tisch saß und in Gedanken versunken, auf eine kleine Marienikone starrte. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich auf sie eingeredet habe, aber schließlich kam sie doch mit nach unten. Ohne sie zu fragen, nahm ich einfach das Marienbild mit.
Die Ikone, (damals wusste ich natürlich nicht, dass man so etwas Ikone nannte) stellte ich in der Krippe direkt vor das Jesuskind und verkündete stolz: »Jetzt hat das Christkind eine deutsche und eine russische Mutter!« Alle sahen mich erstaunt an, aber keiner sagte etwas.
»Jetzt wollen wir ein Weihnachtslied singen«, erklärte Vater kurz darauf. Doch dann drehte er sich zu Anastasia um und meinte: »Vielleicht kannst du vorher ein russisches Lied singen?«
»Oh, … nein, ich nicht singe … aber …«, stammelte sie verlegen und zog nach einer Weile eine kleine, selbst geschnitzte Holzflöte hervor und begann zu flöten. Es war für mich eine sehr fremde Melodie, für meine Mutter wohl nicht, denn sie summte ganz leise mit.
Danach stimmte Vater das Lied ›Stille Nacht, Heilige Nacht‹ an, und ich wunderte mich, dass Anastasia versuchte, zaghaft mitzusingen.
Jetzt durften wir endlich unsere Geschenke auspacken. Aus dem großen Karton konnte ich tatsächlich den so sehnlichst gewünschten Roller herausziehen. Meine Schwester Christa liebkoste gleich ihre Stoffpuppe. Nur mein Bruder Ralf war enttäuscht, dass es statt der erhofften elektrischen, nur eine Holzeisenbahn war, die zum Vorschein kam. Unserem Jüngsten, dem einjährigen Paul, waren die vor ihm liegenden Holzklötze ziemlich egal. Er versuchte, in Richtung Weihnachtsbaum zu krabbeln.
Anastasia bedankte sich überschwänglich für die geschenkten Kleidungsstücke.
Als ich mit dem Roller in der Küche meine Runden drehte, kam Anastasia herein und steckte mir schnell ihre Holzflöte zu und sagte: »Danke, weil du von Stroh nichts sagen.« »Ist doch Ehrensache«, erklärte ich stolz und drehte die nächste Runde.
Am ersten Weihnachtstag warteten wir am Mittagstisch vergebens auf Anastasia. Meine Mutter ging nach oben und es dauerte sehr lange ehe sie zurück kam. Mit sorgenvollem Gesicht erzählte sie dann, dass Anastasia völlig verzweifelt sei und ihr anvertraut habe, dass der Gendarm ihren Freund abgeholt habe. Wie schnell sich bei den Großen doch alles ändert, dachte ich. Vor einigen Wochen war es noch ein Geheimnis zwischen Anastasia und mir. Und heute erzählt sie davon meiner Mutter.
Beim Festessen sprachen meine Eltern erregt miteinander. Ich verstand nur soviel, dass Vater mit dem Bauer reden wollte, bei dem der junge Mann gearbeitet hatte.
Ich spürte, dass die Weihnachtsstimmung im Haus getrübt war und ich überlegte, ob ich hinauf gehen sollte, um zu versuchen Anastasia zu trösten. Aber ich ließ es dann doch sein.
Zwei Tage später schickte mich meine Mutter zur Kirche, um ein Fläschchen Weihwasser zu holen. Als ich zum Weihwasserbecken ging, sah ich in der letzten Bank eine zusammengekauerte Gestalt sitzen.
Das Kopftuch kam mir bekannt vor, und als ich mich vorsichtig heran schlich, sah ich, dass es Anastasia war. Ich war überrascht, denn ich hatte noch nie gesehen, dass sie, solange sie bei uns war, einmal in der Kirche war. Während ich so dastand und überlegte, ob ich sie ansprechen sollte, drehte sie sich plötzlich um. Ich sah, dass sie die Ikone mit beiden Händen fest umklammert hielt und geweint hatte. Dann flüsterte sie mir leise zu: »Ich jetzt weit weg gehe … du nichts sagen? … Bitte!« Dann sprang sie auf und stürzte aus der Kirche. Total irritiert trödelte ich nach Hause und überlegte, was sie wohl mit dem Weitweggehen gemeint haben könnte.
Daheim herrschte große Aufregung, denn meine Eltern hatten bereits das plötzliche Verschwinden von Anastasia bemerkt. Mein Vater wollte sofort den Gendarm anrufen, aber meine Mutter meinte, dass es bestimmt besser für Anastasia sei, bis morgen früh zu warten, denn sie könne ja noch zurückkommen. Ich war froh, dass mich niemand fragte, ob ich sie vielleicht gesehen habe.
Als mein Vater am späten Nachmittag von seiner Milchtour heim kam, ging er sofort in die Küche zu meiner Mutter. Die Beiden redeten und redeten, mal laut und dann wieder leise. Ich versuchte zu lauschen, aber ich konnte nichts Richtiges verstehen. Ich ahnte, dass etwas Schreckliches passiert sein musste, und so fragte ich beim Abendessen:
»Ist was mit Anastasia?« Ich habe meine Eltern selten so niedergeschlagen gesehen, wie in diesem Moment. Lange schwieg meine Mutter, dann nahm sie mich in ihre Arme und murmelte: »Ach, mein Junge! Der schreckliche Krieg ist an allem schuld. Anastasia und ihr Freund sind auf der Flucht erschossen worden. Sie sind jetzt bestimmt im Himmel.«